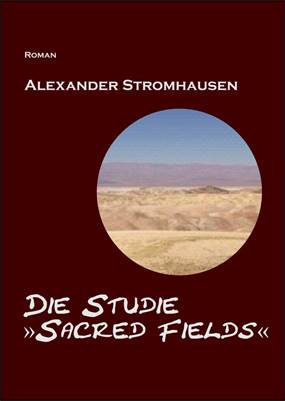Prolog
„Wie
viel?“
„Zwanzig
US-Dollar!“
„Das
ist viel Geld.“
„Du
wirst dafür der Erste sein.“
Der Mann
überlegte kurz, dann griff er in seine Hosentasche und zog zwei verknüllte
Zehner heraus. „Okay; da!“
Der
Junge nahm das Geld und steckte es ein. „Hier?“
„Ja,
hier; sofort; nun mach schon!“, befahl der Mann. Er fingerte aufgeregt in
seinem Piratenbart. In seinem Blick lag die blanke Gier. Mit aufkeimender Lust
leckte er sich die Lippen, während sein Schwanz zu einem prallen Kolben wuchs.
Der
Junge öffnete den Knopf seiner Hose und ließ sie bis zu den Knien
hinabrutschen. Er drehte sich um, beugte sich nach vorne und präsentierte dem
Mann seinen blanken Arsch.
1
Der
Tag war alt in Pakistan. Der Mond strahlte mit seinem kugelrunden Gesicht auf
die Erde und schenkte den Bergen und Tälern einen silberleuchtenden Schleier.
Ein verspielter Wind scheuchte westwärts kleine Wolken vor sich her, die sich
Minuten später zu einem Berg weißer Watte auftürmten. Der funkelnde
Sternenhimmel versteckte allmählich seine Diamanten und konnte sich der grauen
Dunkelheit nicht länger erwehren. Nur noch am Horizont flirrte das Licht der
Straßenlaternen der Stadt Karatschi wie eine pulsierende Glocke bis weit in das
Land hinein und schenkte der Nacht noch einen Hauch von Helligkeit.
Ein
streunender Köter schlich über die Landstraße. Er schnüffelte über den noch
lauen Teer nach überfahrenen Tierkadavern, als sich aus der Ferne die
Scheinwerfer eines Autos näherten. Der Köter schaute auf, beobachtete für
Sekunden den herannahenden Fremdling, senkte dann wieder belanglos den Kopf,
schnüffelte gemächlich weiter nach irgendetwas Fressbarem und verschwand
schließlich in der Düsterkeit der Prärie.
Der
ins Alter gekommene Blechhaufen schnaufte wie ein überanstrengtes Walross über
die Straße. Es war ein VW-Käfer aus den 60ern, der voller Mühe einen kleinen
Wohnwagen hinter sich herzog. Nach etwa einem Kilometer bog er rechts auf einen
schmalen, geschotterten Weg. Der Fahrer schaltete einen Gang runter und trat
das Gaspedal beinahe durch das Bodenblech, um den Wagen eine kleine Anhöhe
hinaufzutreiben. Nach einer scharfen Linkskurve wuchsen in der Ferne Lichter
wie kleine Stecknadelköpfe gemächlich zu Knöpfen heran. Mit jedem Kilometer
trennten sich die skizzenhaften Umrisse deutlicher und erhabener aus der
schwarzen Nacht und eine Ansammlung von Behausungen und Türmen formte sich wie
stumme Schattengestalten aus der unwirschen Einöde. Es war ein
Militärstützpunkt, der weit abgelegen vor der Stadt Karatschi errichtet worden
war. Ein etwa drei Meter hoher Zaun grenzte das Gelände ab. Zehn Wachtürme, die
mit jeweils zwei bewaffneten Soldaten besetzt waren, sorgten für die Sicherheit
rund um das Areal.
An
der Eingangspforte unterhielten sich drei Soldaten miteinander, als der
VW-Käfer auf sie zufuhr. Ein weiterer Soldat trat hinter dem Wachturm hervor.
Er schloss seinen Hosenschlitz, schlenkerte seine Maschinenpistole lässig auf
den Rücken und zündete sich eine Zigarette an.
Alles
schien ruhig.
Der
Fahrer stoppte. Ein junger Mann mit zerzaustem Haar und Piratenbart streckte
seinen Kopf aus dem Seitenfenster. Er grinste verschmitzt. „Hallo!“, rief er
kurz und winkte mit der Hand.
Die
Soldaten öffneten ihm das Tor. Als er an ihnen vorbeifuhr gierten sie durch die
hinteren Seitenfenster in den Fond und begannen augenblicklich zu pfeifen und
zu grölen. Sie schnalzten mit der Zunge und gaben sich gegenseitig anstößige
Fingerzeichen.
Als
der Fahrer mit dem Piratenbart seinen gewohnten Platz etwas abseits der
Unterkünfte im Schatten der Wachturmscheinwerfer erreicht hatte, parkte er sein
Gefährt und würgte den Motor mit einem lauten Knall aus dem Auspuff ab. Er
sprang mit einem flinken Satz heraus und öffnete seinem Fahrgast mit charmanter
Verneigung die Tür. Eine aufgetakelte Hure mit Strapsbändern und hochgesteckter
Frisur kletterte heraus. Sie grinste. Mit kreisender Hüfte stolzierte sie zum
Wohnwagen, knipste die rote Innenbeleuchtung an und verweilte für einen Moment
am Einstieg. Die ersten Soldaten fanden sich rasch ein.
„Sandro!“,
ermahnte sie ihren Fahrer laut und deutlich für jeden hörbar, „Französisch: 25
Dollar; ficki, ficki: 30 Dollar! Keine weiteren Sonderheiten! Und immer nur ein
Soldat! Sonst…!“, mit hochgezogener Oberlippe ließ sie ihre Zähne klappern,
kreiste obszön einladend mit der Zunge um den Mund und verschwand im Wohnwagen.
„Ihr
habt Madame Eleonore gehört! Keine Ausnahmen! Keine Extrawünsche! Sonst beißt
sie euer bestes Stück ab!“, leierte Sandro, als er die Geldscheine der Soldaten
einsammelte. Und er konnte viele Dollars einsammeln.
Die
Soldaten warteten mit angestautem Hochdruck zwischen den Beinen vor dem
Wohnwagen bis sie an der Reihe waren. Nach gut viereinhalb Stunden kehrte
langsam Ruhe ein. Madame Eleonore bediente ihren letzten Gast und schaffte es
mit beruflicher Professionalität und Disziplin, auch aus diesem Herrn noch
alles herauszuholen, als wäre er der Erste gewesen.
Sandro
schlich währenddessen zappelig auf und ab. Er sah auf seine Armbanduhr.
„Fuck!“, fluchte er leise vor sich hin. „Fuck! Fuck! Fuck!“. Fahrig in den
Gliedern zündete er sich eine Zigarette an. Er nahm einen tiefen Zug.
Ein
untersetzt proportionierter Mann mit der Körperlänge eines Zwerges kam im
Gegenlicht der Unterkünfte näher. Sandro blickte angestrengt in die Dunkelheit,
doch er konnte nichts erkennen. „Hassan!?“. Er drehte sich im Kreis, ging ein
paar Schritte auf den Mann zu, stoppte, nahm einen weiteren, tiefen Zug von
seiner Zigarette und starrte mit zirpenden Augenlidern auf die zischende Glut.
Mit schlangenfertiger Zunge zischte er so giftig wie erwartungsvoll sein
stummes Gegenüber an. „Hassan!? Bist du es!?“
Der
Mann hielt inne. Er rollte hastig mit dem Kopf. Mit wendigen Blicken musterte
er die Umgebung. Es war alles ruhig im Lager; nur der Wohnwagen begann
plötzlich monoton rhythmisch zu quietschen…
„Hassan!?
Hassan!?“, flüsterte Sandro nervös.
„Sandro!“,
antwortete eine Fistelstimme. „Sandro, hier! Schnell!“. Hassan zog mühevoll
eine Holzkiste mit der Aufschrift »Coca-Cola« hinter sich her. Er horchte immer
wieder fiebrig in die Dunkelheit. Mit stierenden Augäpfeln suchte er stetig
nach unerwünschten Beobachtern.
Sandro
rannte ihm entgegen. Mit vereinten Kräften schnappten sie die Kiste und
schleppten sie zu seinem Wagen. Da schlug die Haupttüre des Offiziersgebäudes
zu. Die beiden schreckten auf. Wie erstarrt verharrten sie geduckt hinter dem
Auto und lauschten. Ihr Atem begann zu rasen.
„Hast
du etwas gesehen?!“, wisperte Sandro.
„Nein.“
„Scheiße!
Lass uns das fuck Ding drehen bevor uns noch so ein verfickter Offizier an den
Eiern packt!“
„Fuck!
Ja!“
Die
Wohnwagentür ging auf und ein Freier kam grinsend heraus. Er blieb stehen, atmete
tief die frische Nachtluft und sang fröhlich vor sich hin.
Hassans
Muskeln waren vom Gewicht der schweren Last müde geworden. Seine Füße zitterten
in der Hocke. Er konnte sich nicht mehr länger halten und knallte mit dem
Körper gegen den Wagen.
Der
Freier erschrak. Er griff hastig nach seiner Pistole im Gürtelhalfter.
Da
stand Sandro blitzschnell auf und zeigte sich ihm. Er streckte sich müde und
gähnte mit weit geöffnetem Mund.
Der
Soldat erkannte Sandro und lachte. „Du schläfst, während eine Frau für dich das
Geld anschafft! Wow, du hast den Dreh raus!“, sagte er bewundernd und ging
weiter.
„Ja…
genau! Schließlich bin ich der Mann!“, rief Sandro ihm hinterher. Als er ihn
nicht mehr sehen konnte, öffnete er rasch die Vorderhaube seines VW-Käfers. „Schnell!“.
Sie tauschten die schwere Holzkiste mit einer identischen aus und drückten das
Schloss der Vorderhaube wieder leise zu.
„Was
tun Sie hier!?“
Sandro
und Hassan erschraken bis ins Gebein. Das Blut war augenblicklich aus ihren
Gesichtern gewichen. Sie sahen sich aus den Augenwinkeln heraus an, atmeten
rhythmisch flach im Gleichtakt, dann drehten sie sich wie in Zeitlupe um. Vor
ihnen stand der wachhabende Offizier und bedrohte sie mit seinem Gewehr.
Hassan
räusperte sich. Er trat einen Schritt vor und flüsterte, indem er immer wieder
auf das Offiziersgebäude deutete: „Der Oberst hat am Montag Geburtstag. Da habe
ich ihm eine Kiste Coca-Cola besorgt. Die trinkt er doch so gerne.“
„Aufmachen!“,
befahl der Offizier.
Sandro
zögerte, doch er wusste er hatte keine Wahl. Er konnte die Angst deutlich
fühlen, die durch seinen Körper jagte. Vorsichtig öffnete er die Scharniere der
Kiste.
„Nicht
weiter!“, befahl der Offizier. „Treten Sie zurück!“. Er beugte sich etwas in
die Knie. Mit dem Gewehrlauf stieß er den Deckel zur Seite. Immer ein Auge auf
Hassan und Sandro gerichtet löste er für einen eiligen Moment seinen Blick und
sah so erwartungsvoll wie auch überrascht in die Kiste. Eingebettet in Stroh
lagen sechs Flaschen Coca-Cola und eine Flasche Jack Daniels Whiskey. Der
Offizier nickte mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Whiskey! – Werde ich zu
dieser Feier auch eingeladen?!“, fragte er bestimmend.
„Selbstverständlich...“,
antwortete Hassan unterwürfig, „Sie sind herzlich eingeladen.“
„Gut!
Dann bis Montag!“.
Die
Wohnwagentür ging auf. Madame Eleonore knipste das rote Innenlicht aus und kam
heraus. Sie spuckte einen (Kau-) Gummi aus und stöhnte völlig ausgepowert vor
sich hin.
Der
Offizier lachte laut. „Soldaten sind ein gutes Geschäft!“, dann wandte er sich
wieder ab und ging weiter seinen Weg.
„Ja…
und ich bin der Mann!“, rief Sandro ihm hinterher.
„Wer
ist ein Mann? Du etwa?“, fragte Madame Eleonore mürrisch. „Erzähle hier keine
Geschichten und steige ein.“. Sie zog den Mini-Minirock mit einem Griff in die
Hüfte und kletterte breitbeinig wie eine Froschdame in den Fond des kleinen
VW-Käfers.
„Mein
Auftraggeber hat mir für dich keine Dollars gegeben.“, flüsterte Sandro Hassan
zu.
„Ich
will meine Dollars!“, giftete dieser sichtlich wütend zurück. Er ballte seine
Hand zur Faust und hielt sie Sandro unter die Nase. „Wenn ich meine Dollars
nicht bekomme, dann werde ich dir schon zeigen wie man Geschäfte macht!“
„Du
bekommst ja die Kohle. Ich werde morgen die Ware verkaufen und beim nächsten
Mal bringe ich dir deine Dollars mit.“
Hassan
kam Sandro so nah an dessen Gesicht heran, dass sein heißer Atem als eine
feuerzüngige Beteuerung seiner Worte keinen Zweifel offen ließ. „Wenn du mich
anschmieren willst, dann werde ich dir deine verfickte Kehle durchschneiden!“
„Sandro,
beweg endlich deinen Hintern; ich will fahren!“, schnaubte Madame Eleonore aus
dem Seitenfenster.
„Hast
du das kapiert!?“, zischte Hassan.
„Du
wirst deine Dollars bekommen, jeden einzelnen.“. Sandro stieg in seinen Käfer
und startete den Motor; dieser klopfte und ratterte los wie eine alte
Kettensäge, die jemand versehentlich mit Diesel getankt hatte. „Versprochen! Du
bekommst nächste Woche jeden einzelnen Dollar. Dafür stehe ich mit meiner Ehre
und mit dem Leben meiner Mutter.“
„Deine
Mutter interessiert mich nicht. Dein Hals ist mir Pfand genug!“
Sandro
nickte eilend und lächelte dabei mit seinen kariestoten Zähnen so verkniffen,
als hätte er eine Handgranate in den Arsch gesteckt bekommen, deren
Sicherheitsbügel sich mit jeder Bewegung seines Hinterteils würde lösen können.
Mit einem letzten Knall aus dem Auspuff lenkte Sandro das klappernde
Wagengespann aus dem Militärstützpunkt und fuhr zurück nach Karatschi.
Karatschi,
eine der größten Städte der Welt, pulsierte in dieser Nacht wie eh und je.
Motorräder heulten wild durch die Straßen. Taxis waren auf der Suche nach
betrunkenen Touristen. Eine vierköpfige Bande zehnjähriger Jungs mit
italienischem Blut in den Adern rauchte verdeckt zwischen den verrußten Mauern
der ausgebrannten Ruine der »Gesellschaft für religiöse Kommunikation« einen
Joint und fühlte sich stark. Ein paar Häuserblocks weiter wurde im Jahre 2003
das al-Qaida-Mitglied Tawafiq bin Attash verhaftet. Viele Terroristen hatten in
Karatschi ihre Basis aufgeschlagen, um mit militanter Gewalt gegen die
Ausländer der ca. 10 Millionen Einwohner Stadt vorzugehen. Karatschi war in den
Jahren ein guter Übungsplatz für den Krieg in der Welt geworden.
Es
war viertel vor fünf, als Sandro Madame Eleonore zu Hause abgesetzt hatte. In einem
alten Hinterhof in den Immigranten-Slums von Karatschi koppelte er den
Wohnwagen von seinem VW-Käfer und deckte ihn mit einer Plane sorgfältig ab.
Sandro,
ein Pakistani mit italienisch-sizilianischer Abstammung, war seit seiner Geburt
in den Slums der Vorstadt zu Hause. Von seinem Fenster aus im siebten Stock
konnte er die mächtigen Kühltürme des Atomkraftwerkes dampfen sehen. Sandro
bewunderte die faszinierende Technik der westlichen Welt für die gewaltige
Stromgewinnung. Doch er wusste ebenso, dass dieselbe atomare Kraft für den
Kampf gegen Feinde die tödlichste Waffe der Menschheit darstellte.
In
den Slums zählte nur das schnelle Geld zum Überleben. Viele Kleinganoven hatten
Bedenken gegenüber Geschäften, die mit Entführung und gar Mord zu tun hatten.
Das Geschäft mit Sex galt unter den Nicht-Muslimen als die sauberste Methode,
um an Dollars ranzukommen. Die Prostitution war offiziell verboten, doch in
großen Städten wie Karatschi ein wachsendes Phänomen und so versuchten viele,
in diesem Milieu Fuß zu fassen; so auch Sandro. Doch als eines Nachts ein mit
Heroin vollgedröhnter Nigerianer Sandro die Hureneinnahmen rauben wollte, da
war er ausgerastet und hatte ihm im Kampf Mann gegen Mann ein Messer in den
Bauch gerammt. Notwehr oder Mord – in den Slums war dies egal, es zählte einzig
das eigene Leben. Sandro wurde in dieser Stunde zum Töten verdammt und er
wollte sich seitdem keine Moral mehr leisten. So hatte er beschlossen, seine
Geschäfte auf Militärschmuggel auszudehnen.
Eine
streunende Katze schlich um die Mülltonnen und suchte nach Essensresten. Sie
stellte ihren Schwanz, schnüffelte sich durch die herumliegenden Abfälle,
während sie immer wieder innehielt, ihren Kopf hob und für kleine Momente den
merkwürdigen Mann mit Piratenbart aufmerksam bei seinem regen Treiben
beobachtete.
Sandro
nahm ein fingerdickes Seil, führte es durch die Ösen der Plane und verschnürte
den Wohnwagen zu einem sicheren Bündel.
Auf
der Straße parkte zornig ein Toyota-Geländewagen, dass die Reifen mit einem
knappen Quietschen protestierten. Zwei Männer mit übergezogenen Sturmhauben und
in schwarze Umhänge gehüllt sprangen heraus. Mit Maschinengewehren im Anschlag
rannten sie in den Hinterhof.
Sandro
schreckte auf.
„Wo ist die Kiste!?“, schrie einer der
Vermummten, während der andere mit seinem Gewehr auf Sandros Kopf zielte.
„Ahmed?“,
fragte Sandro wirr. „Das bis doch du!? Ahmed, deine Stimme! Unser Geschäft…?!“
„Schluss
jetzt! Wo ist die Kiste!? Wo ist die Kiste!? – Sag schon!“
„Im
Wagen.“, antwortete Sandro.
Der
andere Vermummte rannte zur Vorderhaube des Käfers, öffnete sie und sah die
Kiste. Er stieß hastig den Deckel auf, checkte den Inhalt und nickte seinem
Freund zu.
„Ahmed!
Was… was soll das!? Ich… ich verstehe das nicht! Wir hatten doch immer gute…
gute Geschäfte…!“, stotterte Sandro mit der Angst eines kleinen Jungen im
Nacken.
„Allah
verbietet die Prostitution! Darauf steht der Tod!“
„Was…was
laberst du da? Du hast doch Madame Eleonore selbst schon gefi…“
Schüsse
hallten durch die Nacht.
„Du
Schwein hast meinen Neffen gefickt!“
„Aber…
ich… ihn… bezahlt…“, verstummten Sandros Worte wie holpriges Geflüster. Seine
Lunge flehte in schnellen Stößen nach Sauerstoff, doch das Blut quoll wie
Pudding aus seinem Leib. Er verdrehte seine Augen soweit nach oben weg, dass
die Iris in den Augenhöhlen verschwand und nur noch das Augenweiß vergeblich
nach Licht haschte. Dann fiel Sandro kopfüber auf die Erde und war tot.
Die
beiden Mörder griffen sich eilends die Holzkiste, luden sie in ihren Wagen und
rasten mit qualmenden Reifen davon.
2
Jerusalem; ein Tag später.
Nicole
atmete angewidert. Ein schweres Geruchsgeschwader von Desinfektionsmittel,
Anabolika und anderen undefinierbaren Substanzen lag wie ein undurchdringbarer
Nebel in der Luft. Nicole vermutete, dass der eklige Gestank das komplette
Spektrum der Chemie widerspiegelte. „Ich glaube es ist völlig egal in welchem
Krankenhaus man sich befindet, der Geruch ist immer derselbe.“, sagte sie
leicht verstimmt. „Ich kann diese Luft einfach nicht ab haben!“
„Zum
Glück der Ärzte und deren Patienten kann die menschliche Nase nur zirka zwanzig
Sekunden einen Geruch wahrnehmen. Ich denke, sonst würde sich hier keiner den
ganzen Tag rumtreiben. So krank kann keiner sein.“, antwortete Peter.
„Der
Kerl hat immer noch nicht angerufen! Glaubst du, er wird sich melden?“
„Ich
hoffe es. Ohne dem hohen Tier von der Hamas gibt es kein Interview und ohne
Interview keine Story. Und ohne Story stehen wir beim Sender ziemlich blöd
da.“. Peter zuckte mit den Achseln. „Na ja, eigentlich ist es ja deine Story
und du stehst blöd da, so vor der Kamera ohne Interviewpartner. Blöd.“
„Es
ist unsere Story. Wir sind ein Team. Und wenn von den Herren der Hamas keiner
mit uns reden will, dann stehen wir beide ziemlich blöd da, kapitsche!?“,
nickte Nicole harsch.
„Hey,
ich bin nur der Kameramann, dein persönlicher Knecht, der dir auf Schritt und
Tritt hinterherläuft und dich nur im besten Licht ins Fernsehen bringt.“,
schäkerte Peter und schnalzte mit der Zunge. „Mich sieht hinter der Kamera
keiner grinsen, wenn du vor der Kamera Selbstgespräche führst.“
„Spinner.
Er wird sich melden; das sagt mir mein Gefühl; ganz bestimmt.“. Nicole drehte
ungeduldig das Mikrofon in ihren Händen. Das wird schon klappen. dachte
sie zuversichtlich. Mit versonnenem Blick schaute sie aus dem Fenster und
beobachtete, wie sich eine eher karg gewachsene Palme in der Sonne rösten ließ.
„Puhhhhh…“. Nicole blies ihren heißen Atem langsam durch ihren Spitzmund und
genoss es in diesem Moment besser drinnen wie draußen zu sitzen. Die
Klimaanlage surrte monoton vor sich hin und blies eine angenehme Kühle in den
Besucherraum des Hadassah Krankenhauses. Die »Oase des Friedens« am Hügel En
Kerems am Rande von Jerusalem gelegen, schien all die politischen und
kriegerischen Auseinandersetzungen zu absorbieren. Politik war innerhalb des
Gemäuers kein erwünschtes Gesprächsthema. Sei es der angesehene, jüdische
Chirurg Prof. Dr. Ben Rosenthal, wie auch der für die Sauberkeit der
Räumlichkeiten zuständige Palästinenser Ali Dahlan, der jeden Morgen aus dem
von den Israelis besetzten, östlichen Teil von Jerusalem zu seiner
Arbeit pendelte – jeder von all den beschäftigten Juden, Christen, Moslems
sowie Araber gaben zu Arbeitsbeginn ihre Gesinnung an der Pforte ab.
Sechstausend Mitarbeiter machten in den einhundertdreißig Abteilungen einen
hervorragenden Job im Dienste der Gesundheit für wirklich Jedermann. Und es war
ihnen bei der Behandlung der Patienten egal, ob er Ariel Sharon hieß und zu
seiner Zeit Ministerpräsident von Israel war oder ob der Verwundete eine Kugel
von einer Schießerei zwischen den Rippen hatte und in seinem Schmerz zu Allah
betete.
„Hier
drinnen im Krankenhaus scheint der Friede zwischen den rivalisierenden Gruppen
zu funktionieren.“, staunte Nicole über die Ruhe, die sich ihr eröffnete.
„Draußen auf den Straßen schießen sie sich gegenseitig nieder und hier werden
sie alle wieder zusammengeflickt. Keiner hier drinnen interessiert sich für den
Pass oder die Religion des Patienten. Seltsam wie so etwas gehen kann.“
„Die
Menschen konzentrieren sich einzig und allein auf ihre Arbeit.“, antwortete
Peter. „Wenn Politik und Religion in den Köpfen der Menschen für einen Tag lang
ausgeschaltet werden würden, dann könnten sie für den Frieden und das Wohl
ihrer Selbst und das ihrer Kinder Enormes bewirken. Doch die Menschen wollen es
nicht begreifen. Ich glaube, sie sind einfach zu dumm dafür.“
„Ja.“,
nickte Nicole müde. „Jetzt warten wir schon über eine halbe Stunde. Ich hätte
nichts dagegen, wenn unsere frischgebackene Mama endlich zum Interview
erscheinen würde.“
In
dem Moment ging die Tür auf. Eine alte Dame kam von einer Schwester an der Hand
geführt in das Zimmer, doch als sie Nicole mit dem Mikrofon und Peter mit der
Schulterkamera sitzen sah, winkte sie hektisch ab, stammelte „No, no, no!“ und
machte sofort wieder kehrt.
„Ich
glaube, das war sie nicht.“, scherzte Peter mit einem breiten Grinsen im
Gesicht.
„Na
ja... nur gut, dass wir keine Live-Sendung moderieren müssen. Da würden wir
echt schlecht aussehen.“, seufzte Nicole.
Ein
lautes Scheppern ließ die Tür erzittern. Jemand versuchte sie zu öffnen, doch
offensichtlich mit mäßigem Erfolg dafür mit greller Begleitmusik. Ein Baby
schrie.
„Das
muss sie jetzt aber sein.“. Nicole sprang von ihrem Stuhl auf und öffnete die
Tür.
Eine
Frau, eingehüllt in eine schwarze Abbaja1, hatte vergebens versucht,
die krankenhauseigene Wiege in das Zimmer zu schieben.
„Warten
Sie, ich helfe Ihnen.“
„Danke.“
„Sind
Sie Frau Shihri?“, fragte Nicole.
„Ja, ich bin Haurah Shihri.“, antwortete sie
freundlich. „Herr Madawi sagte mir, dass Sie gerne mit mir sprechen wollen.“
„Herr
Madawi ist unser Kontaktvermittler und Dolmetscher vor Ort. Wir produzieren für
das deutsche Fernsehen eine Reportage über das Leben im Heiligen Land. Wir
wollten auch gerne mit Ihnen darüber reden. Wäre das für Sie okay?“
„Ja.
Sie dürfen nur nicht meinen Namen nennen.“, erklärte Frau Shihri ihre einzige
Bedingung.
Nicole
nickte. „Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. In unserer Reportage
werden Sie nicht zu identifizieren sein.“
Das
Baby schrie noch immer aus vollen Lungen. Mit einem leuchtend roten Kopf und
rasend lauter Sirene machte es seine Umgebung unmissverständlich darauf
aufmerksam »Hey hallo, hier ist jemand, der einen großen Hunger hat!«
Haurah
Shihri nahm ihr Baby aus der Wiege und wippte es sanft im Arm. Sie küsste das
Kleine auf die Wange. „Sie meint sie hat noch Hunger, obwohl ich sie gerade
erst gestillt habe. Dabei hat sie genug bekommen. Das ist auch der Grund,
weshalb ich Sie warten lassen musste; das tut mir Leid.“
„Schon
gut; das macht nichts.“, antwortete Nicole. Mit einer flinken Handbewegung
forderte sie Peter dazu auf, die Kamera einzuschalten und zu filmen. „Ein
Mädchen?“
„Ja.
Sie heißt Acelya. Das bedeutet im Arabischen »von guten Eltern«.“
„Die
hat sie ganz bestimmt. Sie ist süß.“
„Allah
hat uns zwar keinen Jungen geschenkt, aber Allah hat uns ein gesundes Mädchen
in Obhut gegeben. Mein Mann und ich sind darüber sehr glücklich.“, erwiderte
Frau Shihri mit fester Stimme.
Nicole
schluckte ihre aufkeimende Verwunderung über den Anflug von Antifeminismus aus
dem Mund einer jungen Mutter ohne jeglichen Kommentar. Aus ihren Recherchen,
die sie vor ihrer Reise in den Nahen Osten getätigt hatte, wusste sie, dass bei
vielen arabischen Eltern zunächst einmal der Wunsch nach einem Jungen bestand
und ein Mädchen eher als zweitwertig eingestuft wurde. Auch wenn man es nicht
immer versteht, die Menschen sind verschieden und Nicole versuchte das stumm zu
akzeptieren. Sie wollte keine Diskrepanz entstehen lassen, die das weitere
Gespräch hätte beeinträchtigen können. Bei Interviews war nicht ihre
persönliche Meinung gefragt, es war vielmehr wichtig, den Befragten
manipulationslos die Worte aus dem Munde fließen zu lassen.
„Wollen
wir das Interview im Sitzen führen?“
„Ja;
Bitte. Wenn Sie mir nur eine Minute geben, Acelya wird gleich schlafen.“,
antwortete Frau Shihri. Mit federnden Schritten durchkreuzte sie den
Besuchsraum, bis die Kleine die Kehlensirene verstummen ließ, um wenige
Augenblicke später auch schon das Reich der Träume zu besuchen. Die noch junge
Mutter legte Acelya vorsichtig in die Wiege. „Sie wird jetzt schlafen. Unsere
Worte werden sie davon nicht abhalten.“, sprach sie und wippte sanft die Wiege auf
und ab.
„Darf
ich fragen, wie alt Sie sind?“
„Ich
bin siebzehn Jahre alt.“
„Wo
haben Sie so gut Deutsch gelernt?“
„Als
wir noch klein waren hat mein Großvater meinen Brüdern viel von der Deutschen
Geschichte erzählt. Da hatte ich jedes Mal gespannt zugehört. Ich bewundere Ihr
Volk. Es hat Großes geleistet. Ich wollte… nein ich musste von da an unbedingt
Ihre Sprache lernen.“, und wie die Worte aus ihrem Mund sprudelten, lächelte
sie so herzig fromm, als ob ihre Seele vor Freude tanzen würde. „Ist Adolf
Hitler immer noch ihr König? Geht es ihm gut?“
„Nein.“.
Nicoles Stimme strauchelte. „Nein, er ist längst tot.“
„Das
tut mir Leid.“, bekundete Frau Shihri ihr Mitgefühl. „Er war ein großartiger
Mann. Er hat gegen die Juden gekämpft und viele von ihnen getötet. Solche
Männer gibt es in Europa nicht mehr viele. Die Amerikaner haben mit ihren
Dollars vieles zerstört.“
Nicole
zupfte ihr Kopftuch zurecht, doch ihre lange, blonde Lockenmähne konnte sie
einfach nicht verstecken. Sie blinzelte verdrossen mit ihren blauen Augen, die
wie zwei leuchtende Tintenkleckse in ihrem schlanken Gesicht die deutsche
Herkunft nuancierten. „Okay.“. Nicole schlug ihre Beine übereinander, setzte
sich aufrecht hin und versuchte ein weiteres Mal mehr die Worte ihrer
Interviewpartnerin an sich abtropfen zu lassen. „Frau Shihri, Sie sind
Palästinenserin, wohnen eigentlich in Gaza-Stadt, sind bekennende Muslimin und
dennoch haben Sie sich dazu entschlossen, ihr Kind in einem jüdischen Krankenhaus
zu entbinden. Wie würden Sie ihr persönliches Verhältnis zur jüdischen
Bevölkerung beschreiben?“
„Die
Juden haben uns beraubt. Jerusalem ist die Hauptstadt von Palästina.“
„Das
wurde von den Vereinten Nationen nie anerkannt.“, setzte Nicole dagegen. „Genauso
wenig, wie das Jerusalemgesetz von 1980 der Israelis, die darin Jerusalem
ebenfalls für sich als Hauptstadt einfordern.“
„Unser
damaliger Präsident Jassir Arafat hat 1988 Jerusalem zur Hauptstadt von
Palästina erklärt. Wir Palästinenser haben einen Staat und den lassen wir uns
von niemanden und von keiner Nation dieser Erde mehr wegnehmen!“. Die kindliche
Mutter wirkte mehr und mehr gereizt. Mit zackigen Armbewegungen unterstrich sie
unmissverständlich ihre Worte. Und wie ihre schwarze Abbaja durch die Luft
fledderte, kam Nicole das Sinnbild eines Trauerflors in Gedanken. Sie musste
urplötzlich an die Tausenden von Toten denken, die der unermüdliche Hass über
die Generationen hinweg bereits gefordert hatte. Shihris rundlicher Körper
badete unterdessen in einem tosenden Fluss hitziger Redeparolen, während die
kleine Acelya seelenruhig in ihrer Wiege schlummerte. „Juden sind Dämonen!
Diese Teufel haben auch euren Jesus verraten und ihn an das Kreuz nageln
lassen!“. Die Hitze in ihrem Kopf schoss mehr und mehr in die Höhe. „Juden sind
Lügner! Sie töten unsere Kinder! Juden gehören überall auf der Welt gejagt und
getötet, so wie es euer Adolf Hitler getan hatte. Mein Volk wird für die
Wahrheit und für den Sieg über Israel sein Leben lassen! Allah wird uns beistehen!“
„Aber
wenn Sie so voller Feindschaft gegenüber den Juden sind, wieso haben Sie dann
in einem jüdischen Krankenhaus ihr Kind auf die Welt gebracht?“, fragte Nicole
verwundert.
„Die
Juden haben viele unserer Ärzte getötet. Es ist Allahs Wille, dass deshalb die
Feinde Palästinas ihre eigenen, zukünftigen Feinde auf die Welt bringen!“. Frau
Shihri spuckte Speichel. Sie atmete in kurzen Stößen, während ihre Nasenflügel
wild auf und nieder flatterten. „Allâhu Akbar! Allah ist groß!“, stieß sie laut
aus.
Die
kleine Acelya begann augenblicklich mit dem Kopf zu schütteln, als sie
zeitgleich die Augen zu Hautfalten presste, mit einem tiefen Atemzug nach
Sauerstoff lechzte, um in Bruchteilen einer Sekunde schrill loszuschreien. Die
junge Mutter sprach in arabischem Gemurmel auf ihr Baby ein, doch es mochte
nichts nützen; es schien die aufgebrachte Stimmung zu fühlen.
„Noch
eine Frage.“. Nicole versuchte mit ruhiger Körperhaltung Gelassenheit
auszustrahlen. „Die Behandlung in diesem Krankenhaus ist sehr teuer. Wer
bezahlt Ihren Aufenthalt?“ fragte sie mit ausgestrecktem Mikrophon.
Frau
Shihri schüttelte den Kopf. „Geld! Im Westen dreht sich alles nur um das
Geld!“, rief sie zornig.
„Aber
jemand muss doch für Ihre Entbindung bezahlen.“, setzte Nicole energisch nach.
„Wer bezahlt für Sie die Rechnung?“
„Allâhu
Akbar! Allâhu Akbar!“, tobte Frau Shihri voll blanker Wut. Sie fauchte mit
erhobenem Zeigefinger unmissverständliche, arabische Zungenschwadronen, griff
bärbeißig wie eine aufgescheuchte Furie nach der Wiege ihrer Tochter, riss die
Tür auf und stürzte aus dem Zimmer.
Peter
filmte die erbosten Schritte der Kindmutter, wie sie über den Flur flog, um
wenig später hinter einer Ecke zu verschwinden. Er ließ die Kamera noch ein
paar Sekunden laufen, ehe er sie abschaltete.
„Ich
denke nicht, dass diese Frau ihre Tochter für den Frieden erziehen wird.“,
sagte er mit belegter Stimme. Er räusperte sich. „Die hat bestimmt kein Abitur…
Sollen wir dieses Interview überhaupt in unsere Reportage einbinden?“
„Warum
nicht? So denken eben manche Menschen, die hier leben. Abitur können auch nicht
alle haben. Doch dieses Interview gibt vielleicht ein kleines bisschen
Aufschluss darüber, warum die Menschen ebenso sind wie sie sind. Man kann diese
Leute erst in ihrem Handeln verstehen, wenn man versucht, ihre Gedanken zu
verstehen und dazu ist es wichtig, ihnen zuzuhören und ihre Worte ernst zu
nehmen. Weißt du…“, nickte Nicole selbstironisch und dachte dabei an ihr
eigenes Deutschland, „…gerade vermeintlich dumme Menschen sind in der Lage
verheerendes Unheil anzurichten.“
„Tja…“,
stimmte Peter ihr nur leise zu.
„Der
Grund für unsere Reportage ist doch: Wir wollen die Menschen so zeigen wie sie
sind. Schließlich ist dieses Interview als eines von vielen zu sehen. Das wird
im Gesamtbericht untergehen.“, redete Nicole mit dem sachlichen Verstand einer
Reporterin, als Madawi den Flur entlang gerannt kam.
„Es
ist soweit!“, rief er aufgeregt. Sein halb glatziger Kopf leuchtete wie eine
rote Warnlampe, während er mit beiden Händen zu verhindern versuchte, dass bei
seinen hektischen Schritten seine Krawatte nicht in sein Gesicht flatterte.
„Sie haben sich gemeldet!“
„Wann
ist es soweit!?“, gurrte Nicole erwartungsvoll. „Nun sagen Sie schon!“
„Sofort!“.
Madawi keuchte, alsdann sich seine Gesichtszüge plötzlich versteiften. Er
blickte Nicole mit seinen dunkelbraunen Augen beinahe bettelnd an. Seine Hände
zitterten. Er griff in die Hosentasche seiner blauen Jeans, holte ein
Taschentuch hervor und wischte sich den Schweiß aus dem Genick. Mit tiefen
Atemzügen versuchte er sein erhitztes Gemüt zu beruhigen. „Hören Sie Frau
Hauser, dieser Mann ist ein Verbrecher! Ich möchte Ihnen von diesem Treffen
noch einmal abraten! Es wird nicht gut werden!“, flehte er eindringlich. „Es
wird nicht gut werden! Bitte hören Sie auf mich und gehen Sie dort nicht hin!“
3
Der
ein Meter lange Schulterdecker schnurrte in weiten Kreisen über den Himmel. Als
das Flugzeug in einer Spirale der Erde zustürzte, um in knapp zwei Metern
Resthöhe mit einem dumpfen Motorenbrüllen in einer engen Schlaufe dem
Zerschnellen zu entgehen, vernebelte der Wüstensand für einen Augenblick den
Horizont. Dann erschien sie wieder, die Grazie am Himmel. Sie winkte mit den
Flügeln und schien stolz mit ihrem Frontpropeller zu lächeln. Das Modell war
ein perfekter Nachbau der legendären Ryan NYP, der »Spirit of St. Louis«, mit
der Charles Lindbergh am 20. Mai 1927 nonstop von New York nach Paris flog.
„Umar!“.
Ein Mann kam rasch näher. „Umar!“
Umar
Ghamdi steuerte den Schulterdecker mit geübten Fingern per Fernsteuerung durch
die heiße Wüstenluft. Einem Looping folgte ein Schraubenflug, ein
Senkrechtstart, dann wieder ein langer Bogen weit oben im tiefen Himmelblau
über Ramallah.
Ramallah
(was frei übersetzt »Gotteshügel« bedeutet) war eine kleine Stadt mit gerade
mal 57.000 Einwohnern, etwa fünfzehn Kilometer nordwestlich von Jerusalem
gelegen, in den Hügeln Zentralpalästinas. Jassir Arafat, der ehemalige
Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, fand in den Mauern seine
letzte Ruhestätte.
Keine
fünf Kilometer nördlich von Ramallah existierte eine kleine Siedlung von
siebzehn Häusern, die dem Zerfall nahe waren. Nicht einmal mehr die Hälfte der
Behausungen wurde bewohnt. Der Boden der sogenannten »West Bank« war dürr, die
Armut groß und die Möglichkeiten der Menschen durch die triste Lage
aussichtslos.
„Umar,
wir haben ihn.“. Massud schritt stolz über die Terrasse der alten Steinvilla.
Er blieb in gebührendem Abstand von Umar Ghamdi entfernt stehen. Sein Blick
schien starr unter den buschig schwarzen Augenbrauen. Die vernarbte Aknehaut
zog sich wie ein Furchenteppich vom graumelierten Bartansatz bis über seine
langgezogene Stirn, ehe sein Haupthaar den Anschluss fand und den Rest des
Kopfes wie eine zottelig ungepflegte Mütze verdeckte. Aus der wulstigen Nase
wucherten unzählige Haare, die sich jedoch in den halslangen Bart verwuchsen.
„Ich habe ihn herbringen lassen.“, sagte Massud mit dunkler Stimme.
Ghamdi
ließ seinen Flieger nicht aus den Augen. Den Blick fest an den Rumpf fixiert
lenkte er die »Spirit of St. Louis« in die Rückenlage und flog dicht an ihren
Köpfen vorbei. Keiner von den beiden Männern zuckte auch nur mit den Wimpern,
als die Flügel an ihnen vorüberhauchten.
„Weiß
er schon, dass wir es bereits wissen?“, fragte Ghamdi mit eisiger Stimme.
„Nein,
er hat keine Ahnung, weshalb er aus dem Camp abgezogen wurde.“, versicherte
Massud.
„Bring
ihn her!“, befahl Ghamdi regungslos. Er beobachtete die »Spirit of St. Louis«
mit der Konzentration eines Löwen und steuerte sie in den Tiefflug.
Massud
winkte seinem Freund Saddam zu, der am Terrasseneingang wartete. Dieser nickte
und verschwand für einen kurzen Augenblick in der alten Steinvilla, ehe er in
Begleitung eines schmächtigen Mannes wieder erschien. Saddam rempelte ihn an
der Schulter aus dem Haus, hieß ihn mit gestrecktem Arm zum Gehen an und
versperrte ihm mit seinem breiten Oberkörper den Rückweg.
„Hierher!“,
befahl Massud. „Mr. Ghamdi möchte mit dir reden!“
Wie
ein windiger Wurm schlängelte der schmächtige Mann zu ihnen hinüber. Sein
verschmutztes Gewand zeugte von Armut. Seine schweißigen Körperausdünstungen
hüllten ihn in eine stinkende Wolke. Seine Augenhöhlen waren tief eingefallen;
die Wangen nichts weiter als ein Überzug von brauner Lederhaut auf den hervorstehenden
Knochen. Einzig sein Vollbart war gleichmäßig geschnitten. Der Mann zitterte,
während seine Augen wie die eines Adlers jegliche Bewegungen aufmerksam
aufzusaugen bereit waren.
Die
»Spirit of St. Louis« toste durch die Winde. Mit schneller Geschwindigkeit
schoss sie auf den Mann zu. Als der Frontpropeller wie eine Schraube auf sein
Gesicht zuraste, fiel er auf die Knie, ehe das Flugzeug eine Handbreit später
im Steilflug wieder in den Himmel schoss. Der Mann stieß einen gellenden Schrei
aus, kroch zu Ghamdis Füßen und küsste sie. „Allâhu Akbar! Allâhu Akbar!“, rief
er immer wieder zwischen den Küssen. „Allâhu Akbar! Allâhu Akbar!“
Ghamdi
stand wie ein Fels: breitbeinig stark, mit weißem Kurzarmhemd, dunkelbrauner
Anzughose und edlen Lederslippern bekleidet. Seine Oberarme waren muskulös
trainiert. Seine Brust pumpte in langen Atemzügen den Sauerstoff geruhsam durch
seine Adern. Schwarze Haare ohne Grauansatz überzogen sein Gesicht vom Vollbart
bis in den Nacken wie wohlgepflegter Hermelin. Seine Augen schützte er unter
einer Sonnenbrille, während seine knorpelige Nase diese wie eine Heftklammer
festhielt.
„Man
hat in deinen Taschen amerikanische Dollars gefunden!“, zischte Ghamdi zornig.
„Nein!
Nein!“, quietschte der Mann aus seiner Kehle, während er mit hektisch
abwinkenden Händen seine Unschuld beteuerte. „Ich habe nichts getan! Nein! Das
müssen Sie mir glauben!“
„Woher
hast du sie?!“
„Ich
bin unschuldig! Bitte glauben Sie mir!“, flehte der Mann. „Allâhu Akbar! Allah
soll mein Zeuge sein!“
Massud
griff in seine Hosentasche und warf ihm ein abgegriffenes Stoffsäckchen vor die
Füße. „Das war in deiner Tasche! Leugne nicht! Ich habe es dort selbst
gefunden!“
„Ah,
ja! Das meint Ihr! Das… das habe ich… auch gefunden!“, stotterte er. „Ein toter
Soldat! Ich habe es einem toten, amerikanischen Soldaten abgenommen!“
„Unfug!“,
rief Massud. „Er lügt wie ein Ungläubiger!“
„Nein,
ich sage die Wahrheit!“. Der Mann rutschte auf den Knien über die sandigen
Steinplatten, während er mit offenen Händen Allah im Himmel um Hilfe bat.
„Allah möge mir mein erbärmliches Leben nehmen, wenn ich nicht die Wahrheit
sage! Der Soldat war schon tot! Er brauchte die Dollars nicht mehr! Ich schon;
ich habe zwei Frauen und fünf Kinder! Die wollen jeden Tag essen und trinken!
Sie müssen mir glauben!“
„Ich
habe nichts von einem toten US-Soldaten gehört!“, schnaubte Massud.
„Der
amerikanische Soldat lag tot im Straßengraben! Es war…“
„Schluss!“,
brüllte Ghamdi. „Du arbeitest für die CIA! Und ich will wissen, was du ihnen
gesagt hast!“
Massud
zog seine Pistole aus dem Halfter.
„Nein!
Nein!“, stammelte der Mann. Er stand rasch auf und klopfte sich mit der flachen
Hand mehrmals auf die Brust. „Ich bin Ihnen ein treuer Mann! Ich habe nicht für
die ungläubigen Feinde Allahs spioniert! Ich möchte eher sterben, als dass ich
den Amerikanern, den Teufeln aus dem Westen auch nur ein Wort verraten würde!
Ich spucke auf den Feind! Puh! Puh!“. Dann begann der Mann zu weinen. „Bitte!
Bitte! Ich flehe Sie im Namen Allahs an: Verschonen Sie mein Leben!“, keuchte
er. „Allâhu Akbar! Allâhu Akbar!“
„Renne!“,
befahl ihm Ghamdi.
„Wie?
Was?“
„Los,
renne!“
Der
Mann schaute verstört; sein Blick pendelte hektisch zwischen Ghamdis und
Massuds Gesicht hin und her. Massud zeigte mit einem Wink seiner Pistole hinaus
in die Einöde. Der Mann begann augenblicklich kurz zu atmen. Seine Haut
transpirierte den Schweiß in Sekundenschnelle aus seinem Körper und tränkte
sein Gewand in triefendes Nass. In einer über ihn kommenden Panikattacke sprang
er plötzlich auf und lief los. Er wollte schreien, Allah um Hilfe anflehen,
doch seine Kehle war wie zugeschnürt und nur ein gurgelndes Wimmern verließ
seinen weit aufgerissenen Mund.
Ghamdi
steuerte die »Spirit of St. Louis« mit einer weiten Schlaufe in zirka zwei
Metern Höhe hinter dem Flüchtenden her. Er hetzte ihn wie ein Löwe seine Beute
auf der Jagd über den Wüstensand. Auf Knopfdruck der Fernbedienung versprühte
das Flugzeug einen dichten Nebel, der sich einen Augenaufschlag später in einen
Feuerteppich entzündete. Ghamdi genoss es, die Flammenwand über dem Mann
einstürzen zu lassen. Er zog die Atemluft mit wollüstiger Befriedigung tief in
seine Lunge, lenkte die »Spirit of St. Louis« in einem Bogen auf den brennenden
Verräter zu und bohrte sie in einer aufdonnernden Explosion dem Sterbenden in
den Leib.
„Der
Stolz der Amerikaner hat ihn das Leben gekostet!“, brauste Ghamdi zynisch.
„Schneide ihm den Kopf oder was noch davon übrig ist ab und schicke beide Teile
den Amerikanern!“
„Glaubst
du er hat der CIA etwas erzählt?“, fragte Massud, während er mit kindlicher
Neugierde die züngelnden Flammen beobachtete, wie sie das zuckende Fleisch zum
Schmoren brachten.
Ghamdi
zog die Teleskopantenne seiner Fernbedienung ein. Er verpackte sein übriges
Gerät in einem Alukoffer und sprach zu Massud kühl über die Schulter hinweg:
„Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe die Aktion vorgezogen!“
„Was
meinst du mit vorgezogen?“, fragte Massud erstaunt, indem er sein Kinn
spitz über seine Brust nach vorne schob. Mit gespreizten Fingern zog er fiktive
Fragezeichen in die Luft, die er jedoch sogleich wieder verwischte, so, als
wollte er Ghamdis Worte ausradieren. Ghamdi ließ Massud unterdessen einfach
stehen und marschierte mit festem Schritt an Saddam vorbei in das Haus.
Massud
folgte ihm widerwillig. „Eh! Wann soll die Aktion stattfinden? Wir müssen
unsere Freunde informieren! Wir brauchen mehr Zeit! Und was ist mit den
Journalisten?“
In
dem karg eingerichteten Küchenwohnraum befanden sich lediglich ein Gasherd, ein
kleiner Holzschrank mit etwas Geschirr sowie ein Tisch und vier Stühle im Stil
bäuerlicher Einfachheit. Die Wände waren in der Reinheit ihrer Erbauung, einzig
ein grünes Banner zierte den Eingangsbereich, auf dem die Koransure 9,33 in
arabischen Zeichen eingestickt war: »Gott ist es, der seinen Gesandten mit der
Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand zu
verleihen über alle Religion.«.
Ghamdis
zweite Frau Aqdas hatte frischen Kaffee gekocht. Sie nahm den Topf von der Herdplatte
und goss ihn in Trinkgläser, die auf einem Tablett bereitstanden. „Was war das
für ein lauter Knall?“
Der
kräftig würzige Kaffeeduft hüllte den Raum in eine entspannte Atmosphäre, die
jedoch auf Massud keine Wirkung zu haben schien. Sein Gesicht war feuerrot vor
Zorn. „Umar, sage bitte wie das funktionieren soll!“, keifte er wütend.
„Das
Modellflugzeug ist explodiert.“, antwortete Ghamdi seiner Frau Aqdas. Er nahm
sich ein Glas Kaffee vom Tablett, blies mit gespitzten Lippen die aufdampfende
Hitze weg und nippte vorsichtig. „Aber das Spielzeug ist kein Verlust. Es war
nur ein amerikanisches Modell ohne Bedeutung.“. Dann wandte er sich Massud zu.
„Ich habe vor einer Stunde alle Anweisungen durchgegeben. Die Männer sind
bereit, die Journalisten bereits auf dem Weg.“, berichtete Ghamdi und
behauptete mit seinem eigenmächtigen Handeln seinen alleinigen
Führungsanspruch. Er kam Massud bis auf eine halbe Armlänge Abstand näher. Mit
durchdringendem Blick schaute er ihm tief in die Augen. „Du willst wissen wann
es losgeht? – Sofort!“
4
Nicole
hatte sich auf die Rückbank des alten Mercedes 200 gesetzt. Frauen hatten
hinten zu sitzen. Nicole sah darin zwar keinen Sinn, doch war sie es leid, mit
ihrem Kontaktvermittler Madawi jedes Mal von neuem eine Diskussion um die
Sitzplatzverteilung im Auto zu beginnen. Peter legte die Kamera in den
Kofferraum, dann stieg er zu Nicole in den Fond, während im vorderen Teil des
Wagens Madawi sich mit dem Fahrer auf Arabisch unterhielt. Nicole kannte den
Fahrer nicht. Sie dachte, dass er wahrscheinlich wieder einer von Madawis
Mittelsmännern sein musste, der sie hoffentlich zum geheimen Treffen mit einem
hohen Politiker der Hamas bringen würde.
„Wohin
geht die Fahrt?“, fragte Nicole.
„Unser
Treffpunkt ist ein Restaurant in Ramallah.“, antwortete Madawi. „Das ist ein
guter Platz; da sind viele Menschen.“
„Beruhigt
Sie das?“, triezte Nicole.
„Ja,
Frau Hauser, auch wenn Sie meine Vorsicht als übertriebene Angst verurteilen,
doch ich bin hier aufgewachsen und meine innere Stimme ermahnt mich ständig zur
Umsicht. Das hat mir und meiner Gesundheit bisweilen sehr gut getan.“,
widerstand Madawi Nicoles sarkastischer Bemerkung. Er blickte zur
Windschutzscheibe hinaus und ließ seinen Blick über die Straße schweifen. Der
Verkehr drängte um diese Zeit durch die Häuserschluchten wie Ameisen auf dem
Weg zu ihrem Bau. Graue Dunstwolken krochen aus den Auspuffrohren. Der beißende
Geruch der Abgase zog durch die Lüftungsschlitze der Klimaanlage ins
Wageninnere, doch für die Besitzer der Nasen schien dies weniger eine Belastung
zu sein. Denn die unerträgliche Hitze der erbarmungslos vom Himmel brennenden
Sonne hätte binnen Minuten das Auto zu einem Herd mutieren lassen, indem die
menschlichen Braten bald gar gewesen wären. Und so genossen sie die sanfte
Kühle auf ihre Art.
„Entschuldigen
Sie bitte.“. Nicole streifte sich das Kopftuch ab. Sie lüftete die angestaute
Wärme und kämmte sich mit gespreizten Fingern die Haare locker. „Ich wollte Sie
nicht beleidigen.“
„Schon
gut.“
Die
Straße führte hinaus aus Jerusalem. Vorbei an den letzten Häusern im Norden der
Stadt, mussten sie den Checkpoint der Israelis in das Palästinensische
Autonomiegebiet »Westjordanland« passieren.
Der
sogenannte Checkpoint war ein Übergang von vielen zwischen Israel und der
Palästinensischen Autonomiebehörde. Die Straßenschranken waren schwere, in sich
verschweißte Stahlrohre. Betonblöcke als Hindernisse machten es einem
Amokfahrer unmöglich, eine explosive Fracht nach Israel zu bringen. Links und
rechts der Straße trennte ein befestigter Zaun mit Wachtürmen die Gebiete. Das
ist ja wie zu Zeiten, als bei uns in Deutschland die Berliner Mauer noch stand!
dachte Nicole schockiert. Die Soldaten hielten Maschinenpistolen am Abzug;
jeden Augenblick dazu bereit, den Feind zu erschießen. Sie kontrollierten die
Pässe der motorisierten Grenzgänger, durchsuchten die Wagen mit visueller
Gründlichkeit. Die Fußgänger mussten durch einen Gittertunnel gehen, wobei sie
einzeln gefilzt wurden.
„Was
wollen Sie dort drüben?“, fragte der Grenzsoldat, während er Nicoles Pass
inspizierte.
„Wir
sind vom deutschen Fernsehen und drehen eine Reportage über das Leben der
Menschen im Nahen Osten.“, antwortete sie. Das Treffen mit einem Politiker der
Hamas verschwieg sie, um es nicht zu gefährden. Seit geraumer Zeit hatte die
israelische Regierung ihre Strategie in der Bekämpfung ihrer Staatsfeinde
insofern geändert, dass sie vor gezielten Liquidierungen nicht mehr
zurückschreckte. Nicole wusste, dass eine Überwachung ihrer Schritte die
Israelis zu einem hochrangigen Hamas-Politiker führen würde und dies dessen
Todesurteil bedeuten konnte.
„Viel
Vergnügen im Paradies.“, sagte der Soldat mit Ironie in der Stimme und
Sarkasmus in den Augen, als er Madawi seinen Pass zurückgab. Dann winkte er sie
durch die Schranken. Sie durften passieren.
Madawi
war Palästinenser. Nicole war froh um Madawis Anwesenheit, schon allein
deshalb, weil nur ein Palästinenser in der Lage war, die geheimen Treffen in
Palästina überhaupt erst zu organisieren. Keinem Israeli wäre es je möglich
gewesen, einem Fernsehteam ein Interview mit einem Politiker der Hamas zu
vermitteln. Doch Madawis Wesen verbarg noch einen weiteren Vorteil. Die kleinen
Neckereien zwischen ihm und Nicole um dessen Supervorsicht gegenüber jedem noch
so unscheinbaren Gefahrenherd waren zwar Nicole in ihrem Handeln ab und zu
mächtig lästig, doch wusste sie, dass dies trotz alledem im Nahen Osten
überlebensnotwendig sein konnte. Madawi strahlte auf Nicole quasi die
Sicherheit einer Lebensversicherung aus.
Den Checkpoint
hinter ihnen gelassen, führte die Straße vorbei an verdorrten Feldern, auf
denen einst Früchte wie Tomaten und Orangen gediehen waren. Seit Beginn der
Intifada durfte kaum mehr etwas nach Israel exportiert werden. Die palästinensischen Bauern wurden ihrer
Existenzgrundlage beraubt. Plastiktüten und alte Zeitungen mit nichts mehr
sagenden Schlagzeilen wehten unterdessen im Wind über die ausgetrocknete Erde.
Die Aussichten der Menschen waren trist; ihr Leben ein demütigendes Dasein auf nutzlos
fruchtbarem Boden ohne Perspektive auf Besserung. – Welcher westliche
Wohlstandsbürger konnte sich wirklich vorstellen, dass auf diesem Land
längst nur noch der Hass zwischen den Palästinensern und den israelischen
Siedlern keimte; und nicht die Saat von dringend benötigter Nahrung heranwuchs?
In
der Ferne erschien Ramallah auf dem Gotteshügel erbaut wie unnahbar für die
Feinde Palästinas. Und doch waren die Bewohner die Gefangenen eines
Jahrtausende andauernden Konflikts in der Herzkammer der Religionen Islam,
Judentum und des Christentums.
Die
Straßenschluchten von Ramallah waren enge Gassen, die zum Teil so dicht mit
Werbetafeln überhangen waren, dass das nicht einmal in New York genehmigt
worden wäre. Das Verwunderlichste daran war jedoch, dass uramerikanische Firmen
wie Mars-Schokoriegel und Coca-Cola mit ihren Bannern propagierten. So gehasst
das große Amerika doch von den Palästinensern wurde, so gerne schienen sie ihre
Produkte zu genießen.
Die
Menschen drängten sich durch die Geschäfte, huschten über die Straßen,
schleppten ihre vollen Einkaufstüten und hielten ab und dann ein Schwätzchen.
Die Szenen hätten sich so in jeder beliebigen, westlichen Stadt abspielen
können, wären die Erscheinungsbilder der Frauen nicht von Abbajas geprägt und
das der Herren der Schöpfung keine ärmlichen Anzugsverschnitte gewesen. Das
Geld war knapp in Ramallah; man sah es den Menschen deutlich an.
„Sind
wir in der Zeit?“, fragte Nicole.
„Ja.“, antwortete Madawi kurz, während er dem
Fahrer auf Arabisch den Weg wies. Es war eine Kunst, den Wagen heil durch die
verstopften Straßen zu steuern, die nicht immer gelang. Unzählige Blechbeulen
zeugten von belanglosen Kollisionen, die ganz oben auf der Tagesordnung eines
jeden Verkehrsteilnehmers zu stehen schienen. „Da vorne ist es schon!“
„Ist
das das Stadtzentrum?“. Nicole streckte den Hals wie eine Schlange an Madawis
Kopf vorbei. „Ja… da ist der Marktplatz mit dem Brunnen! Ich erkenne ihn
wieder!“
„Das
stimmt. Waren Sie schon einmal hier?“, erkundigte sich Madawi erstaunt.
„Nein.“.
Nicole schüttelte den Kopf. „Ich habe erst kürzlich einen Bericht im
Spiegelmagazin gelesen, indem ein Reporter nach der Familie eines Selbstmordattentäters
suchte. Ein Bild war von hier.“, antwortete sie. „Der Brunnen mit den
emporsteigenden Metallstreben ist unverkennbar.“
Der
Fahrer quetschte den alten Mercedes an den Straßenrand. Zwei vorübergehende
Fußgänger fühlten sich belästigt und pöbelten. Sie riefen mit erhobenen Fäusten
arabische Schmetterworte, zogen jedoch schließlich unverrichteter Fausthiebe
weiter ihres Weges, um an der nächsten Straßenecke erneut einem Rüpelfahrer
Schläge anzudrohen.
„Wir
sind da.“. Madawi deutete mit dem Zeigefinger auf ein Restaurant, das sich an
einer einsichtigen Ecke zum Marktplatz hin befand. Er steckte dem Fahrer
zwanzig US-Dollar zu und stieg aus.
Peter
wollte gerade den Kofferraum öffnen, als der Fahrer den Gang einlegte und
losfuhr.
„Hey!“,
schrie er laut und klatschte mit der flachen Hand auf das Blech, dass es
Donnerschläge hallte. „Hey! Anhalten!“
Der
Fahrer stoppte. Peter holte fix seine Schulterkamera aus dem Kofferraum,
während der Fahrer mit wild fuchtelnden Händen gestikulierte.
„Ach,
geh weiter!“, maulte Peter und schlug den Kofferraumdeckel mit Wucht wieder zu.
Im
Restaurant war für sie reserviert worden. Sie hatten den besten Tisch, um den
größten Teil des Marktplatzes einsehen zu können: Die Menschen wuselten eifrig
umher. Sie murmelten eng aneinander gedrängt. Eine Gruppe Kinder schritt unter
der Obhut einer wachsam schauenden Frau am Brunnen vorbei. Vier junge Männer
spähten mit gestreckten Hälsen über die Köpfe der Passanten hinweg und
tauschten rasche Blicke mit anderen aus, die auf der gegenüberliegenden Seite
des Platzes auf irgendetwas zu warten schienen. Eine Jungfamilie rempelte
hastig durch die Reihen, um kurz darauf in einer Häuserschlucht zu
verschwinden. Weitere Menschen verließen den Platz. Die Marktstände verwaisten
in unauffälliger Ruhe.
Nicole
beobachtete die Szenerie mit Argusaugen. Sie runzelte verwundert die Stirn.
„Wieso sind plötzlich fast keine Frauen und Kinder mehr da?“, fragte sie
erstaunt. „Wo sind die alle hin?“
Peter
schaute etwas verwirrt zu ihr hinüber. „Wie meinst du das?“. Langsam folgte er
mit seinem Kopf ihren Blicken. Zuerst begriff er nicht, doch dann griff er wie
im Reflex nach seiner Kamera und schaltete sie ein. „Unglaublich! Was… was…“,
stotterte er. „Was geht da ab?“
Madawi
erstarrte, ehe ihm sein Körper Sekunden später den Schweiß wie in einem
Fieberschub aus den Poren trieb. Seine Hände begannen zu zittern. Er sprang von
seinem Stuhl auf, blieb einen Augenblick regungslos stehen, machte wie in
Zeitlupe einen Schritt rückwärts und begann unmerklich seiner Lippen leise zu
beten: „Allah, stehe uns bei!“
5
Auf
dem Platz rund um den Brunnen herrschte eine elektrisierte Atmosphäre, die bei
den Menschen eine anomale Reaktion hervorrief: Sie redeten nicht mehr
miteinander. Sie wandelten wie stumme Marionetten in weiten Kreisen umher. Sie
streiften sich in der Menge an den Schultern, rempelten mit ihren Körpern
gegeneinander, doch es schien für jedermann nur ein von Belanglosigkeit
gezeichneter Akt von Zufälligkeit zu sein. Manche von ihnen blickten starr an
den Augen der anderen vorüber, andere stierten einfach nur auf den Boden,
während wieder andere verheißungsvoll zum Himmel aufschauten und leise mit
Allah zu reden begannen. Eine atemberaubende Stille schwebte wie ein in weiße
Leichentücher gehüllter Engel über dem Platz. Es war gespenstisch. Nur der
Brunnen plätscherte in der Gunst des Tages munter vor sich hin; das spritzende
Wasser nebelte in der Gischt der Brunnenschale empor und die Sonne spiegelte
sich in einem kleinen Regenbogen wieder.
Plötzlich
heulte ein Motor laut aus einer Häuserschlucht heran. Es war ein so
grell-schreiendes Geräusch, begleitet von schrill quietschenden Reifen, dass
Nicole erschrocken aufsprang. Neugierig streckte sie ihren Hals ganz lang und
versuchte über die Köpfe der Menschen hinweg den Lärmverursacher zu
lokalisieren. „Ich habe kein gutes Gefühl…“, sagte sie zögerlich, als einen
Augenblick weiter sie ein giftiger Windstoß beinahe mit sich gerissen hätte.
Unweit
von Nicole entfernt schoss ein Kleinbus mit knallig gelber »Nike«
Seitenaufschrift zwischen zwei Häusern hervor. Der Fahrer übersteuerte den Van
in einer scharfen Linksbewegung, woraufhin das Heck ausbrach. Eine Rauchwolke
stieg auf und hüllte die Straßenecke in einen Nebel aus aufgewirbeltem Dreck,
Gummigestank und Bremsstaub. Dann knallte es. Der Kleinbus kollidierte in einen
Müllcontainer. Die Plastiksäcke schleuderten in die Luft, barsten auf dem
Asphalt und der Unrat versprühte in Sekunden seinen faulen Gestank über den
Marktplatz hinweg.
„Ja
spinnt denn der!?!“, schimpfte Peter laut los. „Das hätte Tote geben können!“
Die
Seitentür des Kleinbusses schnellte auf. Zehn Männer in Militäruniformen und
mit Maschinenpistolen bewaffnet stürmten heraus. Sie eröffneten augenblicklich
das Feuer. Ihre Gewehre spuckten innerhalb von Sekunden Tausende von
todbringenden Kugeln über den Platz und mordeten jegliches Leben in
bestialischer Präzision.
„Allâhu Akbar! Allâhu Akbar!“, riefen die
sterbenden Männer, während ihre Mörder Allah verfluchten und immer wieder laut
in die Menge schrien: „Jehova ist größer!“ und:
„Gepriesen sei Jehova!“
Es
dauerte keine Minute, da sprangen die Meuchler zurück in den Van. Und noch ehe
der letzte die Seitentüre schließen konnte, raste der Fahrer über eine Leiche
hinweg, um kurz darauf wieder in den Straßenschluchten von Ramallah zu
verschwinden.
Weit
entfernt toste ein israelischer Kampfjäger heran. Er war zirka einen Kilometer
entfernt, als in seinen Düsen ein dumpfer Donnerschlag explodierte, er in
Schallgeschwindigkeit über die Toten hinweg schoss, um Sekunden später im
tiefen Blau als ein kleiner, schwarzer Punkt wieder unterzutauchen.
Peter
versuchte den Schock in seinen Gliedern in Zaum zu halten. Er atmete tief
durch; zweimal; dreimal… doch die Tränen seiner Seele ertränkten die Freude an
seiner Arbeit. Mit einem eisernen Willen und fest entschlossen seinen Job zu
machen, riss er sich zusammen und ging mit seiner Kamera auf der Schulter
langsam um die Toten herum. Er filmte sie aus der Ferne als ein Feld besät mit
menschlichen Körpern. Er fokussierte die Gesichter mit ihren erstarrten
Mimiken, die den Tod hatten kommen sehen. Manche Antlitze waren mit einem
Schrei auf den Lippen von ihrem Ableben eingeholt worden; andere schienen gar
zu lachen. Manche hatten die Augen zum letzten Blick weit aufgerissen, während
andere ihr Sterben in Dunkelheit fühlen wollten. Manche Gliedmaßen der Opfer
zuckten ein letztes Mal, ehe sie erschlafft den Tod verspürten. Das Blut
sickerte aus den Kleidern der Leichen und sammelte sich in großen, dunkelroten
Lachen quer über den ganzen Platz verteilt.
Inmitten
des Leichenmeeres reckte eine Frau verzweifelt die Arme zum Himmel. „Allâhu
Akbar! Allâhu Akbar!“, schrie sie jämmerlich und weinte die bittersten Tränen
in ihrem Leben. „Allâhu Akbar! Allâhu Akbar!“. Ihr sechzehnjähriger Sohn war
für immer tot.
Andere
Frauen kreischten laut ihrer Verzweiflung aus sich heraus. Sie schluchzten in
bitterem Wehklagen um ihre toten Männer, um ihre toten Verwandten, um ihre
toten Freunde. Die Frauen knieten sich neben ihre Lieben, schlossen sie fest in
die Arme, küssten ihnen das Blut von den Lippen und weinten mit den Köpfen im
Nacken zum Himmel empor. „Allâhu Akbar! Allâhu Akbar!“
Die
herangeeilten Männer, die das Massaker im Schutz ihrer Häuser überlebt hatten,
ballten ihre Hände zu Fäusten. Ihre Gesichter mutierten zu hasserfüllten
Fratzen. Und aus ihren arabischen Kehlen brüllten sie immer und immer wieder:
„Tod den Juden! Tod den Juden! – Allâhu Akbar!“
Nicole
rang nach Luft. Sie wollte losrennen, den Menschen helfen, doch ihre Beine
bewegten sich einfach nicht von der Stelle. Sie wollte etwas sagen, den
trauernden Frauen ihr Mitleid ausdrücken, doch ihr Mund vibrierte nur stumm.
Sie konnte für das viele Leid keine Worte mehr finden. Es brauchte annähernd
zwei Minuten, bis sie sich aus ihrer lähmenden Körperstarre langsam zu befreien
vermochte. „Warum wünschen sie den Juden den Tod?“, fragte sie mit schwacher
Stimme. Ein kleiner Junge rempelte sie an, der eine brennende Israelflagge in
die Höhe hielt. Ihre Knie begannen zu zittern. „Ich verstehe das nicht… weshalb
den Juden…?“
„Haben
Sie die Uniformen der Soldaten nicht erkannt?!“. Madawi wischte sich den
Zornesschweiß von den Schläfen. „Das waren israelische Soldaten!“
„Israelische
Soldaten?“, wiederholte Nicole verwirrt. „Ja… aber wieso sollten sie so etwas
tun?“
„Das
müssen Sie diese Bastarde fragen!“, fauchte Madawi böse.
Nicoles
Gedanken waren in einem Gewirr aus Schreck, Trauer, eisiger Leere und dem
Verlust vom Glauben an die göttliche Gerechtigkeit gefangen. „Das ergibt doch
gar keinen Sinn…“, gebar sie zaghaft aus ihrer Kehle. Sie bemerkte nicht, wie
die Tränen über ihre Wangen flossen. Sie grub ihr aschfahles Gesicht tief in
ihre Hände, schüttelte niedergebeugt mit dem Kopf und seufzte leise: „So viel
Leid…! So viel unendliches Leid…!“
Zwei
Polizeiautos rasten heran. Die Polizisten stiegen ergriffen aus den Wagen. Es
fiel ihnen sichtlich schwer, beim Anblick ihrer toten Landsleute mit ihrem
Innern zu hadern, um nicht weinend zusammenzubrechen. Sie versuchten Fassung
zu bewahren und den Weg für die Rettungskräfte freizubekommen, doch der
grausame Schmerz, den sie fühlten, war ihnen bis ins Gebein hinein gezeichnet.
Plötzlich
erschütterte eine gewaltige Explosion den Marktplatz. Fenster angrenzender
Häuser barsten wie Zuckerguss. Unzählige Splitter flogen wie spitze Pfeile
durch die Luft, um kurz darauf in Mauern, Autos und in Menschen einzustechen.
Nicole
hörte es noch zischen, als sie einen festen Schlag gegen ihren Oberarm fühlte.
Erst als sie nach Sekunden ein pulsierender Schmerz durchdrang, senkte sie
ihren Blick und sah das viele Blut, das ihre weiße Bluse rasch rot färbte. Es
hatte sich eine Glasscherbe in ihren Arm gebohrt, die wie eine heiße Nadel in
ihre Nerven eingestochen hatte. Eine unsichtbare Hand schien die Spitze immer
tiefer in ihr Fleisch hinein zu treiben. Es tat fürchterlich weh. Tränen
schossen ihr in die Augen. Sie öffnete den Mund, sie wollte laut schreien, doch
ihre Kehle war vom Schreck wie zugeschnürt. Sie keuchte. Wie in Trance zog sie
das Scherbenstück aus ihrem Oberarm und ließ es auf den Boden fallen.
„Ach
du große Scheiße!“, schrie Peter laut. „Das war eine Bombe in einem
Müllcontainer! Dort drüben!“
„Sie
sind verwundet!“, rief Madawi.
Peter
versuchte jedes Detail zu filmen. Und noch während er seine Aufnahmen machte,
sickerten Madawis Worte in seinen Verstand ein. „Wer wurde verwundet?“
„Frau
Hauser!“
Peter
stockte der Atem. Er riss sich die Kamera von der Schulter und stürzte herbei.
„Nicole!“, greinte er, als wäre er selbst getroffen worden. „Nicole! Hat es
dich schwer erwischt? Nun sag schon!“
Nicole
schüttelte rasch den Kopf, während ihr Mund vom Schock geknebelt war.
„Wir
müssen hier weg!“, schrie Madawi von Angst beseelt. Er band sein Taschentuch um
Nicoles Arm und zurrte es so fest er nur konnte. „Das wird halten und die
Blutung stoppen!“. Er nickte mehrmals hastig. „Jetzt lassen Sie uns von hier
verschwinden!“
Da
explodierte direkt neben einem Polizeiwagen ein zweiter Müllcontainer und riss
ihn wie eine Streichholzschachtel auseinander. An einer Straßeneinbuchtung
detonierte ein Abwasserkanal unter einem Obstwagen und katapultierte ihn etwa
eineinhalb Meter empor. Einen Sekundenbruchteil später zerfetzte eine
Kofferbombe einen zivilen Helfer, der versucht hatte, den abgetrennten Fuß
eines Opfers abzubinden; dann war er selbst tot. Fünfmal donnerte es und jede
Explosion tötete in unbarmherziger Weise die umstehenden Menschen. Es war
grausam. Das Blut quoll aus den zerfetzten Körpern; es spritzte auf die Leichen
nieder, regnete wie dicke Tränen vom Himmel und färbte das Wasser im Brunnen
purpurrot.
„Los
jetzt!“, brüllte Peter. Eine abgerissene Wagentür schoss wie eine Kanonenkugel
dicht an seinem Kopf vorbei; sie detonierte mit einem brüllenden Widerhall im
Marktbrunnen und fetzte das Fundament in Tausend Stücke. „Los! Beeilt euch!“.
Sein Herz pochte in rasender Geschwindigkeit und drohte ihm beinahe aus der
Brust zu springen. Seine von Schmutz bedeckten Haare sträubten sich wie
Igelstacheln, während seine fahle Haut seine Backen spannte und sie erzittern
ließ. „Das hier ist Krieg! Krieg!“
Madawi
stockte der Atem. Seine Nase begann wild zu flattern, während er mit der Zunge
seine Lippen befeuchtete. „Schnell! Hier lang!“. Seine Stimme krächzte
angsttrunken. Der Schweiß strömte in kleinen Bächen über sein angestrengtes
Gesicht. Das Blut pochte durch seine Wangenhaut und färbte sie leuchtend rot.
Er schnaubte schwer unter seiner stark übergewichtigen Körperlast. Er
verwünschte sich in diesem Moment selbst dafür, ein Mann von erst
achtunddreißig Jahren zu sein, und dennoch die Schwäche in seinen Muskeln zu fühlen,
als hätte er einen Marathon hinter sich gebracht. Sein rotes Haupthaar zierte
nur mehr wie ein dünner Flaum seinen Kugelkopf und bot der heißen Mittagssonne
keine Gegenwehr gegen einen drohenden Hitzschlag. Madawi hasste die prallen
Sonnenstrahlen der Wüstensonne, wie ein Fliegender Hund den Tag. Seine
Körperphysik wollte streiken, doch sein Wille zur Flucht behielt jäh die
Oberhand. Die tief in die Höhlen eingefallenen, weißen Augäpfel versteckte
Madawi hinter einer altmodisch verspiegelten Sonnenbrille und versuchte sich
seine Angestrengtheit nicht anmerken zu lassen. Vergebens. Zwei faule Zähne in
seinem schmalen Mund klapperten wie morsche Holzstümpfe aufeinander und drohten
ihm bei jedem Schritt mit ihrem Abgang. Madawi räusperte sich. „Rechts an dem
Stoffgeschäft vorbei! Links in die Straße!“, herrschte er Nicole und Peter an.
Mit letzter Kraft eilte er ihnen hinterher.
Die
Straße war eine von Geschäftsständen zugekleisterte Gasse; sie war ein
Labyrinth von Gemüsekisten, Tonschüsseln voll mit kulinarischen Köstlichkeiten,
Stoffrollen und unzähligem Kleinkrams.
Die
Menschen hetzten in ihre Häuser. Sie schrien in panischer Angst um ihr Leben.
Es war ein undurchdringliches Durcheinander, indem jeder versuchte, sich selbst
der Nächste zu sein. Manche schlugen sich mit den Ellenbogen den Weg frei.
Hilflose Mütter packten ihre Kinder und zerrten sie von der Straße. Ein alter
Mann, der gestürzt war, krabbelte auf allen Vieren unter einen Gemüsestand und
brachte sich im letzten Augenblick in Sicherheit, ehe eine Meute junger Männer
wie Stiere an ihm vorüberjagte. Sie rafften von den Auslagen der Geschäfte
Schmuck und Seide, ebenso billigen Plunder. An einem Zugang zu einem Hinterhof
prügelten sich zwei Männer um einen alten Fernseher, der neben ihnen im Dreck
lag. Eine Katze kroch aus einem umgestürzten Fass, sprang auf einen Container
und flüchtete mit einem Satz über einen Zaun. Drei Mülltonnen weiter lief ein
Mischlingshund im Kreise seiner Leine, winselte und jammerte, legte sich hin,
kaute das Seil, doch er konnte sich nicht befreien. Dann sprang er wieder auf
und lief mit eingezogenem Schwanz weiter und weiter hin und her.
Staub
wirbelte unter den Tausenden von panischen Schritten der Menschen auf und
vernebelte die Straßen von Ramallah. Sirenen heulten über die Dächer hinweg.
Ein Großaufgebot der palästinensischen Armee und der Polizei rückte an. Sie
sperrten sämtliche Wege, die aus der Stadt führten. Binnen Minuten sicherten
schwerbewaffnete Soldaten der Fatah die möglichen Fluchtwege der Attentäter und
richteten Sperrzonen ein. Die Polizisten durchkämmten mit brachialer Gewalt die
Straßen und verhafteten alle Frauen und Männer, die auch nur andeutungsweise
israelische Gesichtszüge aufwiesen.
„Da
rein!“, rief Madawi.
Sie
rannten in eine Hinterhofparzelle. Rechts und links waren Bretterverschläge,
die durch kreuz und quer genagelte Latten vor dem Einsturz bewahrt worden
waren. Die Dächer waren schäbige Folien, die mit Steinbrocken auf die
Holzgerippe niederbeschwert wurden. Eine alte Frau stierte aus einem Spalt.
Wenige Meter weiter krochen halbwüchsige Kinder in ein Loch und zogen sich als
Sichtschutz eine alte, verdreckte Decke über ihre Köpfe.
„Was
jetzt?“, stieß Nicole aus. Sie ruderte verzweifelt mit den Armen, während sie
hastig nach einem Versteck gierte.
Peter
keuchte; ihm wurde die Kamera schwer. Seine Kräfte zerrannen wie der Schweiß,
der aus seinen Poren quoll und in der trockenen Hitze sogleich wieder
verdunstete. Er mochte sich einen Moment ausruhen, als hinter ihnen Schüsse
knallten.
„Falscher
Weg!“, schrie Madawi erschöpft. Er machte kehrt und wollte zurück rennen, als
sich ihm ein Mann in einem schäbigen Umhang in den Weg stellte. Anfänglich
unbeachtet der dürren Gestalt rannte Madawi auf ihn zu. Da zog der Mann eine
Pistole.
„Stop,
men!“, befahl er in gebrochenem Englisch.
„Wer
sind Sie?!“, schrie Madawi.
Peter
hielt fix mit der Kamera das Geschehen fest.
„Wir
sind ein deutsches Fernsehteam!“, rief Nicole dazwischen. Wie angewurzelt blieb
sie in gebührendem Abstand stehen. „Wir können beweisen, dass den Anschlag
israelische Soldaten verübten!“
„Ich
will das Band! Her damit!“, zischte der Mann und richtete den Lauf seiner
Pistole auf Peters Kopf.
„Wollen
Sie denn nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt!?“, fragte Nicole
konsterniert.
Madawi
musterte den Mann, während er sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß aus den
Augenbrauen wischte. „Mossad!“, nannte er das Kind beim Namen.
„Was!?“,
gurrte Nicole.
„Der
Mann gehört zum Mossad, dem israelischen Geheimdienst.“, klärte Madawi auf. „You are a Mossad-Agent, right!?“
„Ich will das Band haben! Und
zwar sofort!“. Der Mann schoss als letzte Warnung dicht an Peter vorbei, mitten
in ein altes, zirka zwei auf drei Meter großes Werbeschild, dass in
überdimensionalen Lettern für Coca-Cola propagierte.
Peter
zuckte todeserschrocken zusammen. „Ja, ja, ja!“, schrie er aufgeregt. Er hob
seine Hände in die Höhe, kniete sich hastig neben seine Kamera auf die Erde und
öffnete den CD-Ladeschacht. „Schon gut! Schon gut!“, stotterte er. „Sie werden
alles kriegen was Sie wollen! Nur nicht schießen! Nicht schießen!“
Da
zog Madawi blitzschnell seine Pistole. Ohne Vorwarnung schoss er dem Mann eine
Kugel in die Nasenwurzel. Dieser fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden,
zuckte zweimal und blieb reglos liegen. In seinem Hinterkopf klaffte ein
faustgroßes Loch, aus dem eine blutige Masse zäh herausquoll.
„Oh
mein Gott!“, rief Nicole entsetzt. „Sie haben ihn umgebracht!“
„Besser
er als wir!“, schnaubte Madawi. „Schnell, wir müssen weiter!“. Madawi stieg
über die Leiche. „Wo einer ist da sind noch weitere!“
Der
aufgebrachte Mob sammelte sich in Scharen und zog mit tosendem Geschrei in
Richtung Marktplatz. Die Polizisten hatten gegen die hasserfüllten Fratzen
keine Chance. Sie mussten weichen, ließen den kampfbereiten Männern freien Lauf
und verkrochen sich hinter Häuserecken.
„Weiter!“,
brüllte Madawi. Mit gehetztem Blick schaute er sich um. Er stoppte vor einer
Haustüre und verschaffte sich kurzerhand mit einem Fußtritt Einlass. Die
überfallene Hausfrau schrie ihre ganze Angst mit der gesamten Pressluft ihrer
Lunge ohrenbetäubend laut aus ihrer Kehle heraus. Sie wollte die Eindringlinge
mit einem Besen in die Flucht schlagen, doch als sie in Madawis Pistolenlauf
sah, wurde sie still und trat zur Seite.
Madawi
lehnte mit dem Rücken zur Eingangstür. Er schnaubte nach Luft. Er riss sich die
Sonnenbrille von der Nase und dankte Allah um sein Leben.
„Wie
geht es deinem Arm?“, fragte Peter Nicole.
„Bis
eben hatte ich die Wunde gar nicht mehr gemerkt.“, antwortete sie. Sie
betrachtete das viele Blut, das ihre Bluse getränkt hatte. „Schon seltsam, aber
es fühlt sich so an, als wäre mein Arm etwas pelzig; sonst nichts.“
Eine
Maschinenpistolensalve knatterte durch die Straßenschluchten.
Nicole
überkam von neuem ein Gewitter voll Angst und Schrecken. Hoffentlich
schießen sie nicht in die Häuser! Bitte lieber Gott, lass sie nicht in die
Häuser schießen! flehte sie stumm `gen Himmel. Ihre Muskeln waren so
angespannt, dass sich die Sehnen und Adern wie dünne Drahtseile in ihre Haut
eingerbten. Über ihrer linken Schläfe schwoll eine Vene fingerdick an und ihr
Blut floss in rasch zuckenden Stößen in ihr Gehirn. Ich will nicht sterben!
Bitte lieber Gott, lass mich nicht sterben! Ihr Kopf brummte.
Der
Mob auf der Straße brüllte im Chor: „Allâhu Akbar! Allah ist groß! Tod den
Juden! Tod den Amerikanern!“
Peter
konnte durch das Fenster hindurch sehen, wie eine amerikanische Flagge in
Flammen aufging. „Das war knapp!“, seufzte er.
Nicole
nickte. „Ja, verdammt knapp!“
„Das
da draußen sieht nicht gut aus!“
Die
palästinensische Hausfrau rannte aus der Stube und kam mit einer schweren
Eisenpfanne wieder. Sie schrie, holte zum Schlag aus und in ihrer Panik vergaß
sie, dass Madawi eine Pistole am Abzug hielt.
Doch
Madawi steckte sie weg. Er hielt ihr die offenen Hände entgegen und redete mit
ruhiger Stimme beschwichtigend auf sie ein. „Diese beiden Leute sind Freunde
vom deutschen Fernsehen und wir suchen in Ihrem Haus Schutz vor den wütenden
Menschen. Bitte helfen Sie uns.“, bat er auf Arabisch die aufgebrachte Frau um
Hilfe. An der Stubentür stand ein kleines, verängstigtes Mädchen, das sich am
Türpfosten festklammerte und die Fremdlinge mit großen Augen betrachtete.
Da
donnerten Faustschläge gegen die Haustüre.
„Bei
Allah! Helfen Sie uns!“, zischte Madawi. Er ging mit raschen Schritten auf die
Frau zu, nahm ihr die Pfanne aus der Hand und gab sie ihrer kleinen Tochter.
„Ich flehe Sie an: Bitte helfen Sie uns!“
Wieder
dröhnten Fäuste gegen die Holztür. Peter sah vorsichtig zum Fenster hinaus. Da
war niemand. Es schien so, als hämmerte der vorüberziehende Mob gegen sämtliche
Türen, um die restlichen Männer in den Häusern für ihren Marsch zu
mobilisieren. Doch dann sah er sie. „Da sind zwei Soldaten mit
Maschinengewehren!“
Die
Frau sah Madawi an. Sie nickte, drehte sich rasch um und winkte den anderen,
ihr zu folgen. Sie führte sie hinter das Haus in einen provisorisch angebauten
Holzverschlag. Gerümpel wie alte Kartons und leere Getränkeflaschen lagen
verstreut auf dem Boden. Es war dunkel und nur vereinzelt krochen
Sonnenstrahlen durch die Schlitze der Bretterwände. Die Gesichter der dreien
leuchteten in Streifen, als hätten sie sich einen Sträflingsschleier
übergezogen. Die Frau schloss den Verschlag und ging zurück.
Madawi
setzte sich erschöpft auf eine Kiste und atmete tief durch. „Hier sind wir erst
einmal sicher.“
Es
piepste.
„Was
war das?!“, flüsterte Nicole erschrocken. „Das hat sich wie eine Maus
angehört!“. Sie zappelte auf der Stelle. „Scheiße! Etwas ist an meinem Fuß
hochgesprungen!“
„Was
nun!?“, fragte Peter erregt.
Ein
lautes Gepolter drang durch die angrenzende Wand hindurch.
„Still!“,
ermahnte Madawi. Arabisches Stimmengewirr. „Psst!“
Die
Stimmen wurden lauter. Die Frau klagte in schnellen Worten, während im
Hintergrund die Tochter weinte. Eine dunkle Männerstimme giftete dazwischen.
Schüsse
fielen.
Peters
Atem stockte. In den Lichtfetzen des Bretterverschlages starrten seine weiten
Pupillen wie große, schwarze Murmeln in ein weites, leeres Nichts.
Madawi
schüttelte hektisch sein Haupt. „Die Schüsse kamen von der Straße, nicht vom
Haus.“, flüsterte er und horchte weiter den Stimmen.
Nicole
drückte ihr Ohr dicht gegen die dünne Wand und lauschte. Sie hörte ein Klacken
und sie wusste sofort, dass es das Klacken einer Maschinenpistole war, in die
man ein neues Magazin geladen hatte. Um Himmelswillen! war der einzige
Gedanke der wie wild durch ihren Kopf hetzte. Nicole saugte jedes Knistern auf,
als wäre es ihr Letztes. Sie presste ihren Rücken flach gegen die Mauer, kniff
die Lider fest zusammen und wartete auf den großen Knall. Noch nie in ihrem
Leben hatte sie solch eine nackte Angst in ihren Gliedern gefühlt. Sie wünschte
sich bei Gott, aus diesem Alptraum zu erwachen und begann leise zu beten.
„Vater unser, der du bist im Himmel…“
Auf
der anderen Seite heulte die Hausfrau Rotz und Wasser. Ihre Stimme überschlug
sich. Nicole lauschte dem flinken, arabischen Redeschwall. Sie verstand kein
Wort, doch ihre intuitive, frauliche Wahrnehmung ließ sie erneut schaudern. Die
hohe, schnelle Stimmlage, schrille, abgehackte Töne und dann das Klacken der
Maschinenpistole... Was ist da los!? dachte Nicole. Sie wartete wie
unter Strom, bis die Polizisten sie endlich entdecken würden. Wir sind
Reporter und keine Verbrecher! Wieso sollen sie uns etwas antun wollen?!
Schließlich waren es nicht wir, die den Anschlag verübten, sondern es waren die
israelischen Soldaten! Zudem sind wir in der Lage, das mit Hilfe unserer
Aufnahmen auch zu beweisen! Wir können der Welt zeigen, wer die wahren Täter
sind! Also, weshalb würden diese Polizisten uns etwas antun wollen!? Nicole
nickte sich ihren Gedanken taff zu. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn
wir uns ihnen zeigen würden; dann könnten wir unter Begleitschutz diese
brenzlige Lage überstehen! Ja, genau! Sie klemmte die Lippen zwischen die
Zähne und machte einen vorsichtigen Schritt in Richtung Tür. „Wir stellen
uns.“, wisperte sie. „Die Polizisten sollen uns aus Ramallah raus helfen. Wir
sind Reporter. Wir haben Filmaufnahmen, die in ihrem Interesse sind. Die werden
uns nichts tun!“
Madawi
nahm sie beim Arm. Er drückte seine Hand kräftig zu und hielt sie zurück.
Nicole
fühlte wieder, wie ihre Wunde von neuem zu pochen begann. Der Schmerz stach wie
eine Nadel in ihr Fleisch und trieb ihr Tränen in die Augen.
„Nein!“,
flüsterte Madawi energisch. „Wir wissen nicht, ob die Polizisten hinter dieser
Tür für den Mossad arbeiten. Wir befinden uns hier im Krieg. Da sind
Bestechungen an der Tagesordnung. Das Risiko ist zu groß, als dass wir uns
freiwillig zeigen sollten.“
„Er
hat recht!“, gurrte Peter und horchte angestrengt an der Wand. „Psst!“
Madawi
lauschte erneut den Stimmen. Es wurde still.
Peter
schärfte seinen Hörsinn. „Ich glaube sie gehen.“
„Was
ist passiert?“, fragte Nicole.
„Die
Frau hat die Polizisten gefragt, ob ihr Mann bei den Explosionen getötet worden
sei.“, übersetzte Madawi das vorausgegangene Stimmengewirr. „Dann beschimpfte
sie die Israelis und wünschte den Juden den Tod.“
„Oh
mein Gott!“, stieß Nicole betroffen aus. „Wie viel Leid müssen diese Menschen
denn noch ertragen?“. Sie atmete durch die vorgehaltene Hand. Ihr Hauch zischte
warm durch die Finger. „Uns hat sie geholfen, obwohl sie uns nicht kannte.
Ihren Mann hat sie verloren…“
„Das
wissen wir nicht.“, versuchte Peter sie zu beruhigen. „Ihr Mann ist nicht nach
Hause gekommen – na und? Wahrscheinlich ist er einer der wild brüllenden Männer
auf der Straße da draußen.“
Nicole
nickte rasch. „Vielleicht hast du recht.“. Sie wünschte sich jedenfalls, dass
Peter recht hatte und verdrängte jeden weiteren Gedanken an den Tod. Da legte
sie verwundert den Kopf zur Seite und schielte mit weit aufgerissenen Augen
durch die Bretterspalten hindurch auf den Hinterhof. Sie ging näher heran,
stieß mit der Nase in einen Spalt und versuchte, ihren Blick frei zu machen.
„Nein, oder?!“. Ihre Stimme begann hektisch auf und ab zu schwingen. „Oh Gott!
– Das müsst ihr euch anschauen! Wisst ihr, was da draußen rum steht?!“
„Was
soll da sein?“, fragte Peter von rascher Neugierde überrannt. Er stellte sich
neben Nicole und runzelte konsterniert die Stirn.
„Ist
er das?! Was meinst du?“
„Er
hatte jedenfalls auch so eine knallig gelbe »Nike« Werbung auf der Seite.“,
pflichtete Peter ihr bei. Allzu viele davon wird es hier in Ramallah nicht
geben.“
„Dann
ist er es!?“
Peter
nickte. „Ich denke ja!“. Seine Stimme überschlug sich. „Scheiße, ja! Ich denke,
das ist der verdammte Terroristenvan!“
Es
zischte. Eine kleine, fast unmerkliche Rauchwolke stieg unter der Motorhaube
hervor und wuchs in Sekunden zu einem dichten Gemisch aus Ruß und nach Benzin
stinkender Luft. Ein Feuersprudel klein wie eine Wunderkerze flackerte auf.
Noch ehe Peter die Kamera schultern konnte, erschütterte eine ohrenbetäubende
Explosion den Bretterverschlag und riss ihn wie ein Kartenhaus auseinander.
Glühendheiße Feuerzungen fauchten aus den zerborstenen Fenstern des
Kleinbusses. Ein Funkenhagel formte sich wie eine Kugel über der Motorhaube und
verschlang in Windeseile den ganzen Van. Es bildete sich eine Gluthitze, heißer
wie das Feuer der Hölle. Es stank fürchterlich. Der schmelzende Gummi der
Reifen stieg in einer tiefschwarzen Rußwolke in den Himmel empor und
verdunkelte den Tag zur Nacht.
Unweit
des Regierungsviertels startete ein Hubschrauber. Er kreiste in einem großen
Bogen um das Stadtzentrum von Ramallah. Der palästinensische Präsident bekam
Tränen in die Augen, als er das Ausmaß der Zerstörung betrachtete. Er konnte
beobachten, wie die Häuser seiner arabischen Brüder in Flammen aufgingen. Feuersbrünste,
Ruinen und unzählige Leichen zeichneten das Stadtzentrum von Ramallah, des
einzig größten Stolzes Palästinas. Doch nun schien alles zerstört zu sein. Der
Traum von Freiheit und Frieden war grausam gemordet worden.
„Die
Juden werden mir dafür mit ihrem Leben bezahlen!“, fauchte er. „Ich werde erst
ruhen, wenn keiner mehr von diesen Bastarden seinen Fuß auf unser Heiliges Land
setzen kann! Allâhu Akbar! – Allah ist groß!“, schwor der palästinensische
Präsident Rache, als sein Hubschrauber abdrehte und davonflog.
6
Hauptsitz der Central
Intelligence Agency
(Langley im US-Bundesstaat Virginia)
John
Mulder stand am Faxgerät, als es plötzlich losratterte. Er wartete bereits
sehnlichst auf eine Antwort von seinem Freund Majid aus Israel. Sie hatten vor
knapp vier Stunden miteinander telefoniert und vereinbart, dass er ihm bis
spätestens dreizehn Uhr die dringend benötigten Informationen zukommen lassen
würde. Nun war es bereits kurz vor halb zwei, Mulder hatte noch immer nichts
erhalten und in fünf Minuten war Sitzung beim Chef.
„Ist
es das, worauf Sie warten?“, fragte Miss Ellison fürsorglich.
„Nein.“,
brummte John. „Das ist nur so ein blödes Werbefax. Jetzt arbeiten wir hier bei
der CIA und bekommen täglich mindestens zwanzig von den Dingern, obwohl sie
verboten sind. Wieso geht der Sache eigentlich keiner nach?“
„Dafür
fühlt sich wohl niemand zuständig.“, antwortete Miss Ellison und zuckte dabei
lässig mit den Schultern.
Miss
Ellison war die Chefsekretärin der Abteilung SHI-ISR, der »Special Human
Intelligence for Israel«. Die Abteilung, der auch Mulder angehörte, war für die
Anwerbung und Betreuung von Agenten in Israel und der Palästinensischen
Autonomiegebiete zuständig.
„Sobald
ein Fax reinkommt werde ich es Ihnen sofort bringen.“, versicherte sie Mulder.
Sie drehte sich um und wollte zu ihrem Schreibtisch zurückgehen, als ihre Beine
für einen kurzen Augenblick an Ort und Stelle verweilten. Sie blickte
verschmitzt aus den Augenwinkeln und meinte keck: „Sie wissen doch:
Geheimagenten machen es immer spannend. Das kennen wir doch von James Bond.“
„Ja,
Miss Moneypenny. Wie wäre es heute Abend um acht im Sunset-Restaurant zum
Dinner?“
„Guter
Versuch, aber ich habe leider keine Zeit.“, antwortete sie mit flinker Zunge.
Sie ließ den Kopf etwas zur Seite fallen, schlug rasch mit den Augenlidern und
legte mit verspielter Lippenkonversation sanft nach: „Mein Freund kocht heute
für mich.“
„Der
Glückliche.“. Mulder glaubte ein Funkeln in ihren blauen Augen entdeckt zu
haben, dass auf eine gewisse Abenteuerlust schließen ließ. Blonde, lange Haare,
blaue Augen, schmales Gesicht, klasse Rahmen und Beine so lang wie eine Gazelle
– Da wurde bestimmt schon so mancher Mann von Miss Ellison vernascht, schneller
als er sich versah! dachte Mulder und lächelte mit einem solch verbissenen
Kiefer zurück, als hätte ihm jemand ein Stück Zitrone in den Rachen gesteckt. Nur
leider durfte ich noch nicht. „Dann
muss ich jetzt wohl. Der Chef wartet nicht gerne.“. Er griff nach seiner
Unterlagenmappe, die er auf dem Faxgerät abgelegt hatte, klemmte sie lässig
unter den Arm und stakste gemächlich den Flur entlang. Sein rostbrauner Anzug,
seine beigefarbenen Lederslipper und seine Citizen-Platin-Uhr verliehen ihm den
Glanz eines Gentleman; jedoch nicht im Habitus à la James Bond. Mit seinem
Schlender-Wackelgang repräsentierte er eher einen lässigen Snob, der mit einer
etwas arroganten Note Aftershave parfümiert war. Sein Kurzhaarschnitt im
Igellook und seine rahmenlos gefasste Calvin Brille, die sein kantiges Gesicht
zierte, unterstrichen die Optik seines maskulinen 1,82 Meter Körpers auf eitle
Art und Weise. Er wirkte auf die Frauen wie ein Magnet, das auch Nichtmetall in
seinen Bann zu ziehen vermochte. Doch bei Miss Ellison versagte es regelmäßig.
Mulder
sah auf seine Uhr. Majid war bis dato stets zuverlässig gewesen. Und nun, als
Mulder die ausstehenden Informationen in der anstehenden Sitzung so dringend
benötigte, hatte sich sein Kontaktmann zu seinem Leidwesen noch immer nicht
gemeldet.
Mulder
konnte sich noch genau an den Tag vor anderthalb Jahren erinnern, als er in
einem Café in Ramallah einen äußerlich unscheinbaren Mann beobachtete, der
jedoch äußerst kraftgeladen vor alten Gelehrten für den Islam propagierte. Er
wetterte gegen die kompromisslose, gewaltherrliche Machtpolitik der Amerikaner.
Das arrogante Westvolk würde einzig und allein die israelische Angehensweise an
die explosive Problematik bezüglich dem Kampf der Kulturen unterstützen. Tote
Palästinenser, tote Moslems würden vom amerikanischen Präsidenten als
minderwertiger Kollateralschaden achselzuckend hingenommen. Mulder zog vor
Majids gerissener Ausdrucksweise noch heute den Hut. War Majid doch in der
Lage, die älteren Menschen wie auch die Jugend zu erreichen. Und dies in einer
Weise, die Mulder das Gefühl gab, dass dieser Mann sein Leben für seine Worte
opfern würde. Was von den anwesenden Zuhörern jedoch keiner ahnte war, dass
Majid zu diesem Zeitpunkt bereits als Agent der amerikanischen Regierung Lohn
erhielt und er einzig zu dem Zweck seine Rede angezettelt hatte, um in den
Kreis der radikal orientierten Fundamentalisten eindringen zu können. Es
funktionierte. Majids Worte waren in dem Café noch nicht verhallt, da kam ein
alter Mann auf ihn zu und bat ihn um Mithilfe im verdeckten Kampf gegen den
gottlosen und ausbeuterischen Westen. Majid hatte in zwanzig Minuten Redekraft
den Eintritt in eine Terrorgruppe erreicht, von dem sich Mulder wichtige
Informationen im Kampf gegen den fundamentalistischen Terrorismus versprach.
Trotz alledem dauerte es noch anderthalb Jahre, bis Majid auch das Vertrauen
des Chefs der besagten Terrorzelle gewinnen konnte. Und nun, als der Lohn
Majids Arbeit der Lageplan von sieben Terrorcamps im Nahen Osten zu sein
schien, wartete Mulder wie auf glühenden Kohlen auf die golden schwere
Information.
„John!“.
Miss Ellison hielt ein Blatt Papier in die Höhe. „John!“, rief sie, „Warten
Sie! Das Fax ist gekommen!“
Mulder
stoppte auf der Treppe. Er drehte sich um und ließ sich von Miss Ellison
einholen.
„Das
Fax…“, schnaufte sie etwas außer Atem, „…es ist angekommen.“
„Danke,
Miss Ellison. Sie sind ein Schatz.“
Mulder
ließ seine Augen über die in zwei Zeilen sehr kurz gefasste Nachricht schweben.
„Scheiße!“. Er zerknüllte das Papier in seiner Hand und wollte es am liebsten
seiner gleich wieder entledigen. „Verdammte Scheiße!“, fluchte er erneut. Diese
Nachricht war ganz gewiss nicht das, was er erwartet hatte. Mulder legte seinen
Kopf in den Nacken und atmete tief ein. Für einen Augenblick wünschte er sich,
nie bei der CIA angefangen zu haben. Er wollte wegrennen; raus aus der Tür;
hinaus in das weite Valley; einfach nur weg! Doch er hatte eine Aufgabe zu
erfüllen und genau dieser Aufgabe wollte er sich stellen. Er steckte das Papier
in seine Tasche und ging weiter die Treppe hoch. Die Sitzung war bereits im
Gange.
Als
Mulder den Saal betrat, hatte sein Chef Mr. Steinman gerade begonnen, seine
Kollegen zu informieren. In klanglos dunklen Worten leierte er seinen Text so
farblos, als hätte er über nichts Unscheinbareres zu berichten, wie über ein
abgetragenes Paar alter Socken. Doch dem war ganz gewiss nicht so. Steinmans
Ausdruck war eben anders, wie auch der Rest von ihm. Seine schmächtige
Körperform hatte seine Frau mit modischer Kühnheit in einem dunkelbraunen Anzug
zu verstecken versucht. Mit einem weißem Hemd und einer sanft orangenfarbenen
Krawatte unterstrich sie dennoch außergewöhnlich geschickt das nichtvorhandene
Maskuline eines den in die Kategorie unsportlich einzustufenden Antiadonis.
Dank seiner Frau wirkte Steinman trotz seiner unteuren Natur geradezu
charismatisch, diszipliniert und herrschaftlich. Kleider machen eben Leute; zu
Steinmans Glück, denn nackt musste der 1,62 Meter kleine Mann mit seinem weit
über die Stirn verlaufenden, runden Gesicht und seinem zerbrechlich wirkenden
Körperbau wie ein hilfloser Knabe wirken. Nichtsdestotrotz war Steinman sehr
intelligent und hatte sich mit seinen dreiundfünfzig Jahren Lebenserfahrung ein
feines Gespür bei der Führung und Steuerung seiner Agenten angeeignet.
„Es
gab viele Tote!“, rezensierte er.
Ein
Helfer dämpfte das Licht. Ein Film wurde abgespielt. Der Ton war stumm
gestellt.
Mulder
erkannte den Marktplatz von Ramallah oder vielmehr das, was von ihm noch übrig
war. Der Platz war mit Leichen und abgetrennten Gliedmaßen gepflastert; überall
war Blut. Es war ein schrecklicher Anblick. Die grausame Szenerie war an einem
Ort auf der Erde im 21. Jahrhundert Realität geworden.
„Umstehende
Zeugen haben berichtet, dass für dieses Massaker israelische Soldaten
verantwortlich sind!“, tönte die Stimme Steinmans dumpf. „Ich kann das nicht
glauben. Es gibt hierfür auch keinerlei Beweise. Wahrscheinlicher ist, dass es
sich nicht um israelische Soldaten handelte, sondern um kriminelle Attentäter.
Doch wir alle wissen, wie emotional die Menschen in Palästina reagieren. Wenn
einer eine Schuld am Tod von ihren Leuten hat, dann waren es in deren Augen
immer die Israelis. Unsere Aufgabe wird nun sein, die wahren Attentäter zu
stellen. Werden wir dies nicht schnell genug hinbekommen, wird ein Krieg den
Nahen Osten in ein noch weitaus größeres Trümmerfeld verwandeln, als wir es
hier sehen können. Ein Schulterschluss sympathisierender Terrorgruppen untereinander
ist anzunehmen; das sich weitere Sympathisanten in einer Massenhysterie
anschließen, ist sehr wahrscheinlich. Sie, meine Herren, müssen einen Krieg
verhindern, indem ganze Armeen von Muslimen gegen die Juden in den Dschihad
ziehen werden.“. Der Chef hielt für einen Moment inne. Er ließ den Anwesenden
einen Augenblick Zeit, um die grausamen Bilder aufzunehmen und zu verarbeiten.
Mit eindringlicher, monotoner Polemik fuhr er beinahe flehend fort. „Bringen
wir keine Beweise für die Unschuld Israels, dann wird es auch unser Land hart
treffen. Es wird schneller zu einem Flächenbrand kommen wie wir unsere
Kriegsmaschinerie in den Krisenherd schicken können. Denn seien Sie sich über
eins im Klaren: Amerika wird immer an der Seite der Israelis stehen. Andere Länder
werden für die Gegenseite eingreifen; der aufgehetzte Mob wird schließlich mit
bloßen Fäusten gegen uns kämpfen!“. Der Chef füllte kraftvoll seine Lunge mit
Sauerstoff und machte in unmissverständlichen Worten deutlich: „Die Unschuld
Israels ist mit allen Mitteln zu beweisen. Wir haben unseren Kollegen vom
Mossad unser Wort gegeben, alles Erdenkliche hierfür zu tun. Wir werden sie
bedingungslos unterstützen, mit sämtlichen uns zur Verfügung stehenden Mitteln.
Haben Sie mich verstanden? Nochmals: Es gilt um jeden Preis, die Unschuld
Israels zu proklamieren!“. Steinmans Worte waren wie ein Schwall eisiger Luft
in den Ohren seiner Agenten. Und manch einer der Zuhörer hatte das Gefühl, dass
die Wahrheit bereits von der amerikanischen Regierung festgelegt worden war; es
galt nur noch, sie für die Öffentlichkeit zu untermauern. Steinman raunzte:
„Ich höre Ihre Vorschläge!“
Es
stand schlecht um den Frieden. Seit Jahrtausenden wurde die Erde im Nahen Osten
immer wieder von Blut und Leid getränkt und es sollte auch im 21. Jahrhundert
keine Änderung der Geschichte geben. Die Menschen – ob Juden, Muslime oder
Christen – sie alle litten unentwegt unter der tödlichen Auseinandersetzung um
Macht und Land, um den alleinigen Anspruch der einzig wahren Religion anzugehören.
Das
Morden ungläubiger Menschen im Namen Allahs schien für fundamentalistische
Terroristen ein unbedingtes Muss, um in das ewige Paradies zu gelangen. Für
diese Menschen schien morden ein Gebot zu sein, welches für wahre Gläubige ein
nie wieder gut zu machendes Sakrileg bedeutete.
Die
Stille im Saal war von kaltem Schauder erfüllt. Keiner wollte der erste sein,
der seinen Mund öffnete, um mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Falsche zu
sagen. Mulder drückte seinen Körper in seinen Lederstuhl. Er schlug die Hände
vors Gesicht und atmete tief durch seine Finger. Der Hauch fühlte sich warm an
und seine Gedanken machten für einen Augenblick eine Pause. Sein Tischnachbar
lehnte sich zu ihm herüber.
„Hey
John, geht es dir nicht gut?“, fragte er besorgt.
„Was?“.
Mulder schreckte auf.
„Alles
okay? Du siehst etwas mitgenommen aus.“
„Es
geht schon.“, erwiderte er mit gedämpfter Stimme. Er versuchte Gelassenheit
auszustrahlen, was ihm jedoch ausgesprochen auffällig misslang. Mulder hüstelte
auf seinen Handrücken, setzte ein künstliches Lächeln auf seine Lippen und
runzelte seiner Gefühle ertappt verlegen die Stirn. „Und bei dir alles
senkrecht?“
„Aber
sicher, sicher.“, sang Brugger mehr, als dass er sprach.
Der
Chef knallte mit der flachen Hand auf den Tisch. Der Schlag hallte laut wie
eine Kanonenkugel durch den Saal und katapultierte auch die Aufmerksamkeit der
gedanklich entschweiften Zuhörer zurück in seinen Bann. „Ich sage es nochmals:
Lassen Sie uns alles Erdenkliche tun, um einen kriegerischen Flächenbrand im Nahen
Osten zu verhindern!“, beschwor er seine Leute wieder und wieder. Er nahm sich
alle Zeit der Welt und schaute jedem Einzelnen tief in die Augen. „Ich weiß,
Sie alle sind sich Ihrer Verantwortung bewusst!“
Brugger
setzte sich lässig zurecht und knetete mit den Fingern seinen Mund. Er leckte
sich die Lippen feucht und beschloss kurzerhand, die eingekehrte Stille im Raum
zu unterbrechen. „Wer wird schon glauben, dass israelische Soldaten unschuldige
Zivilisten töteten?“, fragte er den Chef mit beinahe ironischem Unterton. Doch
kaum waren seine Worte verhallt, da wurde er sich dem Sinn oder vielmehr dem
Unsinn seiner unwirschen Aussage schnell bewusst.
„Bereits
in dieser Minute brüllen genau dies Tausende von aufgebrachten Palästinensern
auf den Straßen und fordern den Dschihad, den Heiligen Krieg gegen Israel.“,
antwortete Steinman wütend. Er hatte eine ausgesprochen scharfe Allergie
gegenüber manch einer saloppen Aussage seiner Agenten. „Herr Mulder, setzen Sie
sich sofort mit Ihrem Verbindungsmann in Kontakt. Wir müssen schnellstens
wissen: Wer waren diese Attentäter? Was war ihr Motiv? Und: Wo verstecken sie
sich?“
„Das
wird nicht möglich sein.“, entgegnete Mulder. Er holte das Papierknäuel aus
seiner Tasche, welches ihm Miss Ellison auf der Treppe nachgereicht hatte,
faltete es auf und strich es glatt. Er starrte beschwörend auf die schwarzen
Buchstaben, als dass sie sich in eine gute Nachricht verändern sollten, doch es
war vergebens. „Er ist tot. Die Gruppe, in die ich ihn eingeschleust hatte,
muss ihn enttarnt haben. Daraufhin haben sie ihm den Kopf abgeschnitten und ihn
vor unser Büro in Jerusalem geworfen.“
„Diese
Terroristen sind uns einen Schritt voraus.“, sagte der Chef besorgt. Er tippte
aufgewühlt mit einem Kugelschreiber auf die Tischplatte. Seine Gedanken
zirkulierten wie ein Wirbelsturm durch seinen Kopf, doch auch ihm fehlten
plötzlich die passenden Worte. „Das ist nicht gut. Das ist verdammt nochmal
nicht gut!“, erwiderte er mit leergepustetem Gehirn und versuchte einen
Augenblick lang vergebens, den roten Faden wiederzufinden.
Die
Tür zum Sitzungssaal riss auf. Ein junger Mann rannte direkt auf den Chef zu.
Er schnaubte völlig außer Atem. Beinahe stotternd, jedoch mit lauten Worten
überbrachte er die schreckliche Nachricht: „Sir! Bitte entschuldigen Sie die
Unterbrechung, aber der pakistanische Geheimdienst hat uns soeben gemeldet,
dass in einem Militärlager Nahe Karatschi gestern Nacht ein Atomsprengkopf
gestohlen wurde!“
Steinman
sprang von seinem Ledersessel auf. „Gott stehe uns bei!“, stöhnte er entrüstet.
Er beugte sich über die Tischplatte, stützte seinen Körper mit den Fäusten ab,
zog die Luft hastig durch die Zähne und blickte fest entschlossen. „Die Zeit
rinnt, der Wettlauf um den Frieden in der Welt hat begonnen! Wir müssen… nein,
wir werden diesen gottverdammten Atomsprengkopf wiederfinden! Das ist ein
Befehl!“, sprach Steinman unmissverständlich. Er wusste, dass er und seine
Agenten zum Erfolg verdammt waren, wollten sie den Frieden auf der Welt
sichern. Und Steinman ließ daran auch nicht den geringsten Zweifel aufkeimen.
„Mr. Mulder: Sie fliegen sofort nach Israel! Liefern Sie mir die Attentäter,
die den Anschlag in Ramallah verübt haben! – Mr. Brugger, Sie fliegen sofort
nach Pakistan! Finden Sie diesen Atomsprengkopf! Für alle anderen gilt: Ich
will wissen, was das Anschlagsziel der Terrorristen sein wird! Und ich will
wissen: Wann!?“
7
Pakistan, sechs Stunden später.
„Wie
war Ihr Flug, Sir?“
„Geil!
Ich war noch nie mit Überschall unterwegs!“. Brugger grinste breit. Er fuhr sich
mit den Fingern durch die Haare und wuschelte seine kurzen Naturlocken luftig.
„Nur der Helm ist unangenehm. Ich kann Ihnen sagen: Darunter schwitzen Sie wie
ein Affe in der Sauna. Fahren wir direkt zum Stützpunkt?“
„Ja,
Sir.“
„Da
kann ich dann mit dem Soldaten reden, der den Sprengkopf gestohlen haben
soll?“, fragte Brugger argwöhnisch. Er wusste nur zu genau, dass die Gesetze
und die Gepflogenheiten in muslimischen Ländern nicht den amerikanischen
entsprachen. Aber er hatte keine Wahl. Er musste nehmen, was ihm angeboten
wurde.
„Ja,
Sir.“
„Wie
ist Ihr Name?“
„Ich
bin Leutnant Hassan Razzin.“, antwortete er knapp. Er schaltete einen Gang
runter und trieb den in die Jahre gekommenen Ford Granada eine Anhöhe hoch. Der
geplagte Motor hustete wie ein Kettenraucher und spuckte dickschwarze Rußwolken
aus dem Auspuff. Brugger sog die Atemluft zischend durch seine Zähne hindurch,
anschließend schnalzte er mit der Zunge einen dumpfen Plopp. „Ist es noch
weit?“
„Sir?“
Hinter
ihnen verschmolz die Stadt Karatschi langsam mit dem Horizont, während in der
Ferne voraus die Sonne erwachte. Warme, feurige Strahlen erleuchteten den
Himmel und bemalten ihn bunt froh in gelb, rot und lila.
Pakistan
lag an diesem frühen Morgen friedlich im Mittleren Osten wie ein schlafendes
Baby im Kinderbett. Vom Hindukusch Gebirge im Norden bis zum blau schimmernden
Indischen Ozean im Süden, strahlte das Land auf den unbefleckten Betrachter
eine grenzenlose Ruhe und Geborgenheit aus. Der Himmel war völlig wolkenlos,
die Luft zeugte eine angenehme Kühle und allmählich begannen die Vögel mit
ihrem fröhlichen Gezwitscher die anderen Naturbewohner aus dem Schlaf zu
singen. Hätte der Frieden auf Erden einen Vornamen gesucht, zu dieser Stunde
hätte er sich Pakistan2 genannt.
Brugger
beugte sich zu Razzin vor und sprach ihm über die Schulter. „Wie lange werden
wir noch unterwegs sein?“
„Wir
werden in etwa zwanzig Minuten eintreffen, Sir.“. Razzin holte alles aus dem
klapprigen Ford Granada raus, was nur drin war. Der Motor stöhnte unter den
Gaspedaltritten wie ein viel zu alter Gaul, der die Sporen in seinen Lenden zu
spüren bekam. Der Dreck wirbelte aus den Spurrillen der Reifen in einer Wolke
über den ungeteerten Weg und verlieh der hellmorgendlichen Taxifahrt ein
old-spicy Flair, wie es Brugger aus alten John Wayne Schinken her kannte.
Razzin hingegen interessierte sich nicht für amerikanischen Kitsch. Er hatte
eine lange Nacht hinter sich, war nur noch müde und wollte seinen Fahrgast
schnellstmöglich wieder aus seinem Wagen haben. In seiner geistigen Routine
gefangen, steuerte er fahrtrunken durch die weite Prärie. Seine Konzentration
war inzwischen unter den Nullpunkt abgedriftet, sein Zustand glich dem eines
hypnotisierten Wachjunkys, als er sich nach einer uneinsichtigen Linkskurve
plötzlich einem Hindernis aus deutschem Blech gegenübersah. Ein alter Mercedes
Benz versperrte ihm die Weiterfahrt wie ein Damm dem Wasser den Weiterfluss
abschnitt. Ein überdimensionierter Adrenalinschub versetzte sein Blut in
Sekunden in eine einzige, mikroskopische Flutwelle und katapultierte seinen
Geist in Blitzeseile auf Hochtouren. Razzin trat mit der ganzen Kraft seines
Beines auf die Bremse. Mit gestreckten Armen wartete er auf den Aufschlag. Doch
Widererwarten seiner eigenen Reaktion, hielt der alte Ford Granada eine
Handbreit vor der Stoßstange des Mercedes.
„Puh!“,
schnaufte er erleichtert.
Wasserdampf
quoll unter dessen Motorhaube hervor und vernebelte die Sicht.
„Was
ist da los?“, quengelte Brugger aus dem Fond. „Kann der Penner seine Kiste
nicht von der Straße schieben?“
Eine
dunkle Gestalt kam mit schnellen Schritten auf sie zu. Der Mann versteckte
seine rechte Hand in der Innentasche seine Jacketts, so dass er Brugger
deutlich zu verstehen gab er träge eine
Waffe und ward bereit, sie sogleich zu ziehen. Brugger wollte nach seiner
Pistole greifen, doch die lag noch gut verstaut in seinem eilig gepackten
Koffer und dieser wiederum ungreifbar im Kofferraum. „Geben Sie Gas!“, befahl
er Razzin mit hastiger Stimme. „Schnell! Den Rückwärtsgang!“
Razzin
drehte seinen Oberkörper rechtsseitig über die Schulter und blickte Brugger
konsterniert in die Augen. „Sir?“
„Lassen
Sie uns abhauen!“
Da
öffnete der Mann die Beifahrertür und setzte sich ungefragt zu ihnen in den
Wagen. Mit einem flinken Handschlag und für Brugger in unverständlicher
Urdu-Landessprache befahl er Razzin, den liegengebliebenen Mercedes vorsichtig
mit der Stoßstange von der Straße zu drängen, um ihn umfahren zu können. Er zog
ein weißes Taschentuch aus der Innentasche und wischte sich erschöpft den
Schweiß von der Stirn. Dann drehte sich der Mann Brugger zu.
„Verzeihen
Sie meine Unhöflichkeit. Sie müssen Mr. Brugger sein. Mein Name ist Abu UlHaq.
Ich gehöre dem pakistanisch militärischen Abwehrdienst
Inter-Services-Intelligence, kurz ISI, an.“, stellte er sich vor, lächelte mit
verkniffenen Lippen und reichte Brugger über die Rückenlehne hinweg die Hand
zum Gruß. „Ich sollte Sie eigentlich erst auf dem Militärstützpunkt treffen,
doch leider hat die deutsche Qualitätsarbeit auch noch kein Mittel gegen
verrostete, alte Kühler gefunden.“
„Wie
wäre es mit einem Neuen.“, entgegnete Brugger trocken.
„Tuschée!
Aber leider sind Ersatzteile in Pakistan so gut zu bekommen wie rote Rosen im
Hindukusch Gebirge.“. UlHaq zuckte verstohlen mit den Schultern.
„Sie
sind doch vom ISI… da sollte so ein Kühler ein Kinderspiel für Sie sein.“,
reizte Brugger weiter.
„Tuschée,
tuschée! Wollen Sie mich schon heute Morgen bei diesem schönen Sonnenaufgang
erstechen?“, fragte UlHaq mit pakistanischer Gelassenheit. „Ist es nicht
herrlich da draußen?!“. Er öffnete das Seitenfenster einen Spaltbreit. Ein
frischer Windzug strömte in das Wageninnere und kühlte die Köpfe. UlHaq atmete
tief ein. „Herrlich! Nicht wahr?! Fast so schön wie in Hollywood.“. Er drehte
sich Brugger zu. „Natürlich ist nichts so schön wie in Hollywood. Klasse Frauen
haben Sie dort, ohlala!“
Brugger
hatte nach dem anstrengenden Nachtflug in einem Kampfjet keine Lust auf dieses
dünne Gesülze und noch dazu vor dem Frühstück. Sein Magen knurrte. So gab er
keine Antwort. Er schaute unterdessen stumm zum Fenster hinaus und verbiss sich
die Zähne. Wäre dieser Scheißtyp für ihn nicht eine wichtige Kontaktperson
gewesen, wären sie beide nicht in so einer alten Mühle gefangen und hätte
Brugger seine Pistole am Mann gehabt, dann hätte er Mr. Kackredescheiß Abu
UlHaq längst eine Kugel zwischen die Augen verpasst. Ja, Bruggers Blutzucker
schien im Keller zu sein, während seine Aggressivität wie eine geschüttelte
Cola-Flasche zu explodieren drohte.
„Sie
reden morgens nicht viel, nicht wahr?“, flachste UlHaq. Er musterte Brugger wie
dieser aus dem Fenster starrte, nickte seinen eigenen Worten leise zu, drehte
sich um und verschloss für den Rest der Fahrt fest seinen Mund.
Auf
dem Militärstützpunkt herrschte bereits reges Treiben. Eine Soldatengruppe
joggte über einen Kiesweg, ein angehender Offizier parkte einen Panzer zwischen
zwei Bäumen und etwas abgelegen an der Seite pinkelte ein übernächtigt
aussehender Wachposten in eine Hecke. Die beiden Männer im Pfortenhäuschen
lehnten ebenso lässig wie gelangweilt in ihren Stühlen. Sie griffen sich
breitgrinsend mit den Händen an die Eier und kontrollierten gerade die
morgendliche Spannkraft ihres nächtlich abgenützten, kleinen Mannes, als Razzin
an die Schranke heran fuhr. Anfänglich bequemten sie sich nur allmählich und
ließen nur widerwillig an ihre faulen Hintern Luft, doch als sie UlHaq als
Beifahrer erkannten, sprangen sie wie von Taranteln gebissen auf und öffneten
mit übereiliger Hast und mäuseduckendem Kopfnicken die Schranke.
UlHaq
führte Brugger zu einem abseits gelegenen Gebäude. Während ihr Fußmarsch sie
über weite Teile des Militärgeländes führte, erkundete Brugger mit Argusaugen
die Bauten und die Lage der tief im Boden befindlichen Raketensilos. Er verglich
das Abbild mit seinen Erinnerungen, die er vor gut neun Stunden mit den letzten
Satellitenbildern von diesem Ort aufgefrischt hatte. Die Pakistani glaubten
offensichtlich nicht einmal selbst daran, dass die Amerikaner nicht über die
Militärbasis Bescheid wussten, sonst hätte UlHaq Brugger unter Garantie nicht
so arglos über das Gelände geführt.
„Hier
sind wir schon.“, blökte UlHaq. Er öffnete Brugger die Tür zu einem Bunker,
dessen Treppen tief in die Erde hinab führten. Das blecherne Metall der Tritte
plärrte unter den stampfenden Füßen der beiden Männer wie eine widerstrebend am
Schwanz gezogene Katze. Seichte
fünfundzwanzig Watt Birnen versuchten vergebens, die Stufen in helles Licht zu
tauchen. Es war kühl. Ein muffiger Gestank von Fäulnis und übermäßigem
Kohlendioxid ließ Brugger nach Atem ringen. Er hätte den fahlen Geschmack in
seinem Mund am liebsten auf den Boden gespuckt, doch seine Höflichkeit verbot
es ihm. Das Gemäuer war zu einem Beet für tellergroße Schimmelflecken geworden.
Die Wände waren so verdreckt, dass Brugger einen schwarzen Streifen auf seinem
Hemd wiederfand, nachdem er mit dem Ellenbogen nur kurz gestreift hatte. Das
Gebäude ließ jeglichen Standard an Vertrauen missen. Nicht einmal Spinnen
mochten mehr darin wohnen und ihre Netze dienten längst nur noch zum Filtern
des Flugstaubs. Agenten haben es auch nicht leicht! dachte Brugger und
folgte UlHaq in gebührendem Abstand, während sich das Kellerverlies wie ein
Labyrinth mit unzählig kleinen Kammern mehr und mehr verzweigte. Unten angekommen,
flackerte eine Neonröhre und verströmte mit kurzen Lichtstößen nur wenig
Helligkeit.
Als
sie den Verhörraum betraten, saß bereits ein in sich eingefallener Mann auf
einem kargen Holzstuhl und röchelte nach Luft. Sein hageres Gesicht war von
geronnenem Blut verkrustet, seine Nase verschoben, sein Wangenfleisch fast dem
Platzen nahe angeschwollen. Der Kieferknochen des Mannes war für Bruggers
Begriffe mindestens zweimal gebrochen. An der linken Hand war der Stumpf seines
abgetrennten Zeigefingers mit einem verfranzten Stück Stoff nur notdürftig
abgebunden. Der Mann starrte apathisch auf die Kettenfesseln an seinen
Handgelenken, die sich tief in sein Fleisch eingeschnitten hatten.
Brugger
nahm sich einen Stuhl, setzte sich mit der Lehne zum Bauch verkehrt herum,
stützte seine Ellenbogen auf und sah dem Mann endlose Sekunden in die Augen ehe
er mit fester Stimme schließlich fragte: „Verstehen Sie meine Sprache?“
Der
Mann saß zitternd auf seinem Stuhl und atmete in schnellen, kurzen Stößen. Er
schien seinen Geist in einen Dämmerschlaf geführt zu haben, um die ihm
zugeführten Schmerzen ertragen zu können. Er zog seinen triefenden Rotz die
Nase hoch und verharrte mit gefalteten Händen.
„Verstehen
Sie mich?“, wiederholte Brugger harsch.
„Er
kann Sie sehr gut verstehen.“, antwortete UlHaq für den Mann.
„Ich
frage Sie jetzt nur einmal: Wo ist der Sprengkopf?“. Brugger redete mit
ruhigem, jedoch eindringlichem Tonfall.
Doch
der Mann blieb stumm.
Brugger
stieß ihn plötzlich mit gestreckten Fingern in die Brust. „Hey, Mann! Entweder
Sie sagen mir sofort, was ich wissen will, oder ich beiße Ihnen einen Finger
nach dem anderen ab und stecke Sie Ihnen in den Rachen!“
Nach
einer halben Minute regungsloser Untätigkeit hob der Mann langsam den Kopf. Er
riss seinen Mund weit auf. Er fauchte, jedoch nur mit der Kraft seiner Lunge,
ohne seine Stimme zu benutzen. Ein Schwall Blut tropfte über sein Kinn auf sein
zerrissenes T-Shirt. Dann konnte Brugger es sehen… es war gespenstisch!
Brugger
betrachtete den Mann starr vor Schrecken. Er kämpfte einen Augenblick lang
gegen eine aufsteigende Übelkeit, atmete mit hastig vibrierenden Nasenflügeln
und verließ schließlich ohne weitere Worte den Raum.
Abu
UlHaq folgte ihm. „Was ist los?“, rief er Brugger fragend nach. „Sind Sie schon
fertig?“
„Sie
haben den Mann gefoltert!“, fauchte dieser wie ein zorniger Löwe.
UlHaq
zuckte mit den Schultern. „Schließlich wollten wir wissen, wo die Bombe ist.“,
entschuldigte er sich. „Freiwillig wollte er uns nichts sagen.“
„So
wie Sie den da drinnen zugerichtet haben, da hat er Ihnen doch alles gesagt,
was Sie hören wollten!“
UlHaq
schüttelte erhaben den Kopf. „Er hat geredet; das ist richtig. Ich war von
seiner Antwort nur nicht gerade sagen wir… überzeugt.“
„Sie
waren nicht überzeugt?“, bläffte Brugger entrüstet. „Was hat er Ihnen denn
gesagt, dass Sie nicht gerade überzeugt hat?“
„Er
hatte eine Kiste Coca-Cola unter seinem Bett versteckt. Wir wollten lediglich
wissen, woher er sie hatte. Da behauptete er frech, sie noch nie gesehen zu
haben. Sie müssen wissen…“, UlHaq bekundete seine Aussagen mit erhobenen
Zeigefinger, „…in der Kiste war auch eine Flasche Jack Daniels Whiskey. Dieser
Mann da drin ist ebenso wie ich ein sehr gläubiger Moslem; uns ist Alkohol
streng untersagt.“
„Sie
haben diesen Mann nur wegen einer Kiste Coca-Cola und einer Flasche Jack
Daniels so zugerichtet?!“
„Nein.
Wir wollten eigentlich wissen, wer die Bombe jetzt hat.“. UlHaq fühlte sich
missverstanden. Er räusperte sich. „Was sollten wir tun? Ihn etwa laufen
lassen? Oder hätten wir ihn etwa mit einem Blumenstrauß nach Hause zu seiner
Mutter schicken sollen?“
„Es
reicht!“, unterbrach Brugger ihn forsch. Er fauchte unstet: „Und… hat er Ihnen
gesagt, wo die Bombe jetzt ist?“
„Nein.
Das hat er uns bisweilen verheimlicht.“
„Wieso
haben Sie ihm dann die Zunge herausgeschnitten?!“, schrie Brugger sich
ungehalten vor Zorn seine Wut aus der Kehle, dass ihm sein Speichel wie dünner
Regen aus dem Mund sprühte.
„Wir
haben ihm gedroht, er hat nichts gesagt… na ja, da war dann seine Zunge eben
futsch!“. UlHaq hob beide Arme in die Höhe und fächerte seinem Herzen mit
flachen Händen die reine Unschuld zu. „Sollten wir etwa unsere Drohungen nicht
einhalten?“
„Haben
Sie schon einmal daran gedacht, dass dieser arme Kerl da drinnen gar nichts mit
der Sache zu tun haben könnte?“
„Das
kann nicht sein.“, wiegelte UlHaq kopfschüttelnd ab. „Eine Flasche Jack Daniels
ist in unserem Land viel wert.“
„Ist
ein Whiskey bei Ihnen so wertvoll wie eine Atombombe?“, spottete Brugger.
UlHaq
strich sich nacheinander die Augenbrauen glatt. „Möglich. Viele Menschen tun
auf dieser Erde viele dumme Sachen für nichts.“
„Unfassbar!“,
stöhnte Brugger. „Ich glaube das alles nicht!“
„Finden
Sie es heraus. Gehen Sie wieder zu ihm rein und verhören Sie ihn weiter.“
„Können
Sie mir sagen, wie ich aus diesem Mann noch Informationen herausholen soll?!“.
Brugger ging einen Schritt auf UlHaq zu und hob den rechten Zeigefinger. „Falls
Sie es bereits vergessen haben: Sie haben dem armen Kerl die Zunge
herausgeschnitten!“
„Hey,
Sie sind Amerikaner! Sie werden das schon hinbekommen.“, lächelte UlHaq.
Ermunternd klopfte er Brugger auf die Schulter. „Amerikaner bekommen doch alles
hin, nicht wahr? Sie schaffen das schon. Hey, Mann…“, sülzte er mit seiner
schlabberig, schmierigen Visage die Kacke vom Himmel. „…ich vertraue Ihnen.
Hören Sie, ich vertraue Ihnen.“
„Kann
er schreiben?“, fragte Brugger.
„Nein,
er ist Analphabet.“
Brugger
drehte sich genervt ab und marschierte den Korridor in Richtung Ausgang.
„Wo
wollen Sie jetzt schon wieder hin?“, quiekte UlHaq. „Was ist nun mit dem
Verhör?“
„Vergessen
Sie’s!“
„Was
soll das heißen: Vergessen Sie’s?“, fragte er mit dem treuen Unschuldsblick
eines falschen Katers. „Wie soll es jetzt weitergehen?“
„Was
denken Sie, wie es weitergeht?“, fragte Brugger scharfeckig. „Sie wissen nicht
zufällig, wo dieser arme Kerl die ach so teure Jack Daniels Flasche her haben
könnte?“
UlHaq
lächelte verschmitzt, ehe er seine Lippen auseinander brachte: „Da gibt es eine
Nutte… ihr Fahrer besorgt den Soldaten ab und zu verschiedene Kleinigkeiten...“
„Sie
lassen in dieses Militärlager mit Sicherheitsstufe 1 eine Nutte mit ihrem
Fahrer rein?“, fragte Brugger mit nüchterner Verwunderung. „Wow! Echt wow!“.
Brugger entfesselte sich seinem Erstaunen und meinte mit zuckenden Schultern:
„Dann bringen Sie mich mal zu dem Fahrer der Nutte. Vielleicht kann der uns ja
weiterhelfen. Wer weiß, vielleicht hat er ja gerade eine Atombombe im
Schmugglerangebot.“
„Äh…“,
stotterte UlHaq. „Da gibt es ein klitzekleines Problem…“
Brugger
blieb abrupt stehen.
„Der
Mann… der ist tot.“
Brugger
hob abermals den Zeigefinger, sog seinen Atem mit einem Pfeifton durch seine
gefletschten Zähne und starrte UlHaq tief in die Augen.
„Hören
Sie, was kann denn ich dafür?“, verteidigte sich UlHaq. „Ich habe ihn nicht
umgebracht.“
„Dann
fahren wir zu der Nutte! Oder ist die auch bereits tot oder hat keine Zunge
mehr?!“, brummte Brugger, während sein Blut von Adrenalin getrieben durch seine
Adern schäumte. Es kochte regelrecht in ihm und er selbst wartete nur darauf,
bis der heiße Dampf ein Auslassventil finden würde. Gnade war demjenigen
geboten, der sich dann seiner Faust in den Weg stellen würde.
„Was
wollen Sie bei dieser Nutte? Die weiß nichts.“, erwiderte UlHaq verdrossen.
„Haben
Sie sie schon verhört?“
„Nein!
Eine Nutte ist nur ungläubiger Abschaum und eine Schande für jeden aufrichtigen
Moslem. Wie könnte so eine Person uns weiterhelfen?“
„Ich
will dennoch mit ihr reden!“, schnaubte Brugger.
„Sie
wollen was?!“. UlHaq schob seine Unterlippe über die obere und schüttelte den
Kopf. „Nein, das geht nicht. Wie ich Ihnen bereits sagte: Sie ist eine Nutte…“
„Schluss
jetzt!“, schnitt Brugger ihm das Wort ab. „Ich habe genug von Ihrem Gewäsch!
Sie bringen mich nun sofort zu der Nutte oder ich sehe mich gezwungen, Ihrem
Vorgesetzten Ihre unkooperative Verhaltensweise zu berichten!“. Brugger kam ihm
so nahe, dass UlHaq seinen heißen Atem auf der Haut fühlen konnte. „Ich habe
beinahe den Verdacht, Sie haben etwas zu verbergen!“
UlHaq
stampfte auf der Stelle. Hätten Blicke töten können, wäre Brugger tot
umgefallen. „Okay, ich bringe Sie.“, antwortete UlHaq zornig. Er senkte seinen
Blick und marschierte stumm an Brugger vorbei. Die nächste halbe Stunde hatten
sie nichts mehr miteinander zu bereden.
Es
war kurz vor zehn Uhr am Vormittag. Die Rushhour war voll im Gange. Die Sonne
brannte erbarmungslos vom Himmel und Brugger sehnte sich nach einer Klimaanlage.
Doch einzig durch die geöffneten Wagenfenster zog ein nach Abgasen stinkender
Luftzug, der nicht wirklich für eine Abkühlung sorgte.
Der
tosend monotone Klang von Karatschis Straßen stülpte sich wie eine Glocke über
die Stadt. Die überwiegend alten Kisten wurden von ihren Besitzern mehr durch
die überfüllten Häuserschluchten geparkt als gefahren. Es war an diesem Morgen
wie an jedem Morgen: ein sehr zäher Verkehrsfluss, der die Nerven der Menschen
äußerst strapazierte. Manch einer hupte sekundenlang, ehe ein anderer ihm mit
abwinkender Hand die Sinnlosigkeit seiner bescheuerten Huperei verdeutlichte.
Alte Mofas tuckerten gefährlich nahe zwischen den Autos hindurch; rempelte mal
ein Lenker an einem Blech vorbei, schien dies nicht jeden zu belasten. – Na ja,
die Pakistani sind eben keine Deutschen, die ihr heiliges Blechle mehr lieb
haben, als ein Karawanenführer sein Kamel. Als die Ampel auf Rot schaltete,
kroch ein pulsierender Teppich geknüpft aus unzähligen Menschenköpfen über die
Straße. Die Ampel wieder auf Grün, brachte Brugger mit seinen pakistanischen
Gefährten nur mühsame Meter Vorteil ein.
UlHaqs
Handy klingelte. Er redete in schneller, Urdu-Symphonie eine kurze Arie. „Zum
Hafen!“, befahl er Razzin.
„Zum
Hafen?“, wiederholte Brugger borstig, während er sich mit seinem Hemdausschnitt
frische Luft zufächelte. „Was sollen wir da?“
„Vertrauen
Sie mir. Sie werden überrascht sein!“
8
Eine
Maus, die hastig über den heißen Teer huschte, wurde von dem schweren Stiefel
eines erhitzten Soldaten tot getreten. Der kleine Kopf barste, das blutende
Fellknäuel tapezierte einen purpurnen Fleck auf die Straße.
Der
Hafen war abgeriegelt worden. An der Kontrollstelle zu den Piers passierte
gerade ein Leichenwagen die Absperrung, die aus alten Ölfässern und einem
Holzbalken provisorisch zusammengebastelt worden war. Der Fahrer fuhr in
Schrittgeschwindigkeit über die mobilen Straßenkrallen hinweg, rollte an einer
links liegenden Bucht langsam aus und reichte dem Soldaten bereitwillig die
Papiere durch das Seitenfenster.
Razzin
wurde durchgewunken.
Als
Brugger den Leichenwagen musterte, traf sich für Sekundenbruchteile sein Blick
mit den tiefschwarzen Augen des Beifahrers. Es schauderte ihn beim Anblick des
fahlen Vollbartträgers, dessen vernarbte Gesichtshaut Brugger an einen längst
vergangenen Einsatz im Irak erinnerte.
Es
war vor drei Jahren, als er bei einem Sonderkommando zusammen mit Mulder den
Topterrorist Achmed bei einem Feuergefecht erschossen hatte. Mulder und er
hatten noch darum gefeilscht, wessen Kugeln den Schurken nun in die Hölle
geschickt hätten, die seinigen oder Mulders. Doch so sehr der Mann, dessen
kalte Augen Brugger wie ein Pfeil in das Herz stachen, diesem Achmed auch
ähnelte, die CIA selbst war es, die den Tod Achmeds durch einen DNA-Test
bestätigt hatte.
Die
umstehenden Menschen verfolgten mit gelassener Gleichgültigkeit die
Militäraktion, von der sie glaubten, dass es sich wieder einmal mehr um eine
unangemeldete Razzia handelte. Es war seit den Anschlägen in New York am 11.
September 2001 auf die Zwillingstürme des World Trade Centers keine Seltenheit,
dass auf den Piers in einer unangemeldeten Sonderaktion nach Waffen und Drogen
gesucht wurde. Für die Hafenarbeiter bedeutete es stets eine willkommene Pause
von ihrem Knochenjob, während die Schiffseigner wie raffgierige Hyänen auf die
Soldaten einredeten und versuchten, mit Bestechungsgelder die eigenen Schiffe
von den unnötig neugierigen Blicken der Kontrolleure zu verschonen. Zeit war
Geld; je länger ein Schiff im Hafen stand, desto mehr Dollars gingen dem Eigner
verloren. Doch an diesem Tag schien alles anders. Keiner der Soldaten blinzelte
auch nur mit den Augen, als ihnen die Dollarscheine unter die Nasen gehalten
wurden.
Razzin
stoppte den alten Ford Granada an Pier 9. Sogleich trat ein Soldat heran und
öffnete Abu UlHaq die Tür.
„Sagen
Sie mir endlich warum wir hierher gefahren sind und nicht zu der Nutte!“,
kläffte Brugger wütend.
UlHaq
ließ Bruggers Zorn arrogant über die kalte Schulter hinweg abtropfen. „Haben
Sie Geduld.“, erwiderte er kurz und stieg aus. „Es wird Ihnen gefallen.“
Brugger
wurde die Höflichkeit nicht zuteil, dass ihm jemand die Tür öffnete.
Schließlich war er kein privilegierter Agent des ISI, sondern für die Soldaten
nur ein geduldeter, direkt vom Staatsministerium zugewiesener CIA-Agent; eben
einer aus dem fernen Amerika. Nicht jeder in Pakistan liebte den amerikanischen
Way Of Life und schon gar nicht deren Agenten im eigenen Land. Auch Abu UlHaq
war der Befehl der obersten Behörde ein unaussprechlicher Groll gewesen. Er
hatte es als gläubiger Moslem nicht verstehen können, warum ihr Präsident
ausgerechnet die ungläubigen Amerikaner um Hilfe bei der Wiederfindung der
Bombe gebeten hatte. Er hatte damit die Kompetenz der Agenten des ISI
unmissverständlich in Frage gestellt und überdeutlich unterstrichen, dass das
pakistanische Volk nicht im Stande gewesen war, eine so gefährliche Bombe zu
schützen. Nun würde es bald die ganze Welt von der sogenannten freien Presse
des Westens erfahren, dass Pakistan zu inkompetent war, um sich alleine gegen
Terroristen zu verteidigen, obwohl in Abu UlHaqs Augen der eigentliche Feind
doch der Westen mit seiner egoistischen Politik war.
Das
Schiff mit dem Namen »Moses« trug die israelische Flagge. Es war eine zirka 50
Meter lange Jacht mit abgedunkelten Fenstern, einem Swimmingpool, zwei
Wasserbetten, einer Bar und einem Speisesaal mit einem Original Picasso-Gemälde
an der Wand. Zudem war der Luxusliner ausgestattet mit einer selbstjustierenden
Satellitenschüssel, einem Radar und Sonar – eigentlich nichts
Außergewöhnliches, jedoch zu extravagant und zu pompös, um in Bruggers
Jahreskalender »Die besten Spionageboote des Jahres« aufgenommen zu werden.
Außerdem war da noch die regelrecht zur Schau getragene, israelische Flagge...
Brugger
runzelte verwundert die Stirn.
UlHaq
ließ den Kapitän auf das Pier führen, wo ihn bereits ein Journalistenteam
erwartete. Etwas abseits hievten zwei Soldaten eine Art Truhe auf ein Podest,
die den Glanz einer aus billigen Brettern notdürftig zusammengenagelten Kiste
ausstrahlte.
UlHaq
trat mit einem stolzen wie auch einem äußerst aggressiven Gesichtsausdruck an
das Mikrofon. „Wir haben heute einen schweren Anschlag auf unser Land vereiteln
können!“, fauchte er und untermalte seine grenzenlose Erregung mit geballter
Faust in die Kamera. „Eine Gruppe israelischer Terroristen wollte diese
Atombombe in unser Land schmuggeln, um einen verheerenden Anschlag gegen
Pakistan und damit ebenso gegen den Glauben aller Muslime zu verüben!“
„Was
faselt er da?!“, flüsterte Brugger sich selbst zu. Fassungslos schüttelte er
den Kopf, während er sich von der rasanten Abfolge der Situation überrascht mit
den Fingern die Nasenspitze sanft massierte. „Das gibt es doch nicht!“
Zwei
in weiße Overalls gehüllte Männer fuchtelten unprofessionell mit einem
Geigerzähler aus den Fünfzigern um die alte Kiste herum. Ein aufgeregtes
Tackern übertrugen sie per Mikrophon.
„Hören
Sie den Beweis!“, raunzte UlHaq tosend vor Wut. „In dieser Truhe befindet sich
eine gefährliche, eine schmutzige Bombe! Tausende von unschuldigen Vätern mit
ihren Söhnen sollten morgen Abend beim großen, heiligen Pilgeraufbruchsfest
nach Mekka getötet werden! Nur das wohlüberlegte Handeln unserer Soldaten
konnte diese schreckliche Tragödie in letzter Sekunde verhindern!“. UlHaq
präsentierte seine Aufgebrachtheit mit hochrotem Kopf und fauchender Zunge.
Sein Speichel spritzte wie ein Schwall Gift aus seinem Mund und sprühte einen
fahlen Nebel in die Kamera. Von seinen stampfenden Beinen begleitet, hallten
seine Worte wie eine Attacke zum Angriff gegen die Scheinfreunde des
pakistanischen Volkes in die Ohren der Reporter und ließen keinen Zweifel
daran, wie die Schlagzeilen der kommenden Nachrichtenausgaben aussehen würden:
»Juden wollten Muslime morden!«
Abu
UlHaq wandte sich dem Kapitän zu. Er betrachtete ihn mit hypnotischem Blick,
als wollte er ihn warnen, das pakistanische Volk kein weiteres Mal zu
demütigen. „Vermasseln Sie es jetzt nicht!“, flüsterte UlHaq dem Delinquenten
unmissverständlich ins Ohr, ehe er die Presse und die Schaulustigen mit seinen
Worten weiterfütterte. In einem Taumel blinder Euphorie der gefälligen Meute diesen
Juden als Terrorboss vorgestellt, reckte UlHaq die Fäuste zum Himmel und
beschwor im Namen Allahs seine eigene, ganz persönlich formulierte
Gerechtigkeit. Alle Menschen sollten ebenfalls zu seiner und genau zu seiner
Überzeugung gelangen: Ja, dieser Mann war der Feind! Juden sind Feinde!
Bestraft sie alle!
„Sprechen
Sie zu den Leuten, die Sie töten wollten! All die unschuldigen Muslime dieses
Landes werden Ihnen zuhören, wenn Sie ihnen erklären, warum sie sterben
sollten!“, fauchte UlHaq und spuckte dem Mann vor die Füße. „Sie Abschaum von
einem unehrenwerten Mann! Nun reden Sie endlich!“
„Ich…“,
stotterte dieser, „…ich bin Jude und ich spucke auf euch Muslime.“.
Die
versammelte Menge erstarrte. Ein bestürztes Raunen zog sich bei den Worten des Juden
durch die Reihen und jeder einzelne verspürte in dieser Sekunde den Hass über
Israel in sich aufkochen.
„Woher
hatten Sie diese schmutzige Bombe?! Reden Sie schon!“
„Israelische
Soldaten hatten das Ding auf mein Schiff gebracht.“, flüsterte der Mann verängstigt
in das Mikrophon.
UlHaq
holte mit der flachen Hand weit aus und schlug dem vermeintlichen Juden mit
voller Wucht ins Gesicht. „Wir haben genug gehört! Führen Sie dieses Schwein
ab!“, befahl er seinen Männern. Er wandte sich den Menschen zu und sprach mit
langsamer und dunkler Stimme ohne weitere Umschweife: „Jeder, der versucht,
auch nur einen Moslem zu töten muss wissen, dass er dafür mit dem eigenen Tod
bezahlen wird!“
Die
Menschen am Pier waren verstummt. Der Schock saß tief in ihren Gliedern.
Niemand hatte bis dato auch nur einen Funken eines Gedankens daran
verschwendet, dass Israel dem Land Pakistan feindselig gestimmt hätte sein
können. War der pakistanische Präsident doch ein direkter Freund vom
amerikanischen Präsidenten und dieser wiederum der beste Freund der Israelis.
Die sich nun neu dargebotene Situation zwischen Muslime und Juden wirkte
unheimlich auf die Menschen. Sie verspürten Angst. Eine Angst untermauert von
Unsicherheit. Wollten die Juden gar in den Krieg gegen ihr Volk ziehen? Wenn
ja: warum? Was hatte Pakistan den Juden nur angetan? Die Menschen fanden darauf
einfach keine Erklärung…
„Unglaublich!“,
fluchte Brugger leise. „Dieses Schwein UlHaq beschuldigt die Israelis die
scheiß Bombe ins Land gebracht zu haben! Das wird ein Nachspiel haben!“. Er
fletschte unbemerkt seiner Sinne die Zähne, dass ein jeder zufällige Beobachter
seinen Zorn sogleich bemerkt hätte. Er zog die Luft pfeifend in seinen Mund und
ließ seinen boshaften Gedanken freien Lauf: Und dieser israelische Volldepp
ist sich wohl nicht bewusst, dass er soeben sein Todesurteil gesprochen hat! Brugger
holte eine Digitalkamera aus seiner Hosentasche, schnaubte und wandte sich
schließlich verdrossen ab. Es war ihm nicht vergönnt, seiner kargen Kenntnis
öffentliche Wahrheit zu verleihen und so fotografierte er alles was ihm nicht
geheuer vorkam… und das war in seinen Augen verdammt viel!
Am
Anlegeplatz zwei Boote weiter, parkte unterdessen der Leichenwagen neben einem
Frachtschiff, das unter saudi-arabischer Flagge fuhr. Arbeiter hievten den
schweren Bleisarg über die Reling. Der fahlhäutige Araber kommandierte die
Männer harsch, während er die Trauer um den Toten in bemitleidenswerter
Gleichgültigkeit zu erleben schien.
„Sir!“
Brugger
erschrak. Er drehte sich hastig um und blickte zu seiner Verwunderung inmitten
Razzins fahles Gesicht. Er atmete flach, als wäre er kurz davor zu
hyperventilieren.
„Sir…“,
stotterte Razzin, „…ich möchte, dass Sie wissen, dass Mustafa die Bombe nicht
gestohlen hat.“
„Was
meinen Sie?!“, fragte Brugger erstaunt.
„Der
Soldat Mustafa, dem sie die Zunge herausgeschnitten haben… er hat die Bombe
nicht gestohlen.“. Razzin schaute sich hektisch über die Schulter. Er hatte
Angst, dass er beobachtet wurde, doch er konnte nichts Auffälliges erkennen, sprach
jedoch mit sehr schneller Stimme weiter. „Ich hatte eine Kiste Coca-Cola und
eine Flasche Jack Daniels Whiskey geschmuggelt. Ich war das. Doch keiner hat
eine Bombe gestohlen; nur etwas Elektronikkram.“
„Elektronikkram?
Wovon sprechen Sie?“
„Von
so ein bisschen Elektronikscheiß, den die Armee eh nicht vermisst. Hey, kommen
Sie… jeder schmuggelt hier ständig irgendetwas.“, antwortete Razzin verlegen.
„Aber ich habe niemals Sprengstoff geschmuggelt, Sir. Niemals!“
„Aber
vielleicht hatte Mustafa die Bombe gestohlen, ohne dass Sie etwas davon
mitbekommen haben.“
„Wissen
Sie, Mustafa ist wie ein Kind.“, Razzin kreiste mit seinem gestreckten
Zeigefinger an seiner Schläfe. „Ganz bestimmt nicht. Mustafa hat ganz bestimmt
nie etwas gestohlen. Dafür ist er ein zu gläubiger Moslem.“
„Okay.
Als Sie dann von der gestohlenen Bombe und den bevorstehenden Durchsuchungen
hörten, da hatten Sie die Kiste…“
„Ja!“,
unterbrach ihn Razzin. „Da habe ich die Kiste mit dem Jack Daniels Mustafa
unter das Bett geschoben. Ich bin Christ, verstehen Sie? Wenn man bei einem
Christen eine Flasche Whiskey findet, dann widerspricht dies nicht meinem
Glauben, doch die muslimischen Kommandanten nehmen dies zum Anlass sich
brüskiert zu fühlen. Sie bestrafen die Christen, während sie bei einem von den
ihrigen ein Auge zudrücken.“. Razzin pochte der Atem. „Ich konnte doch nicht
ahnen, dass sie ihn beschuldigen würden, die Bombe gestohlen zu haben…“
„Und
dass sie ihn foltern würden.“, sprach Brugger den Satz zu Ende.
„Mustafa
hat die Bombe nicht gestohlen, das müssen diese Leute wissen. Ganz bestimmt
wissen die das... und dass er nie das Gegenteil behaupten kann, da haben sie
ihm einfach die Zunge herausgeschnitten.“
Brugger
starrte hinüber zum Frachtschiff. Er beobachtete, wie Arbeiter den Sarg vorsichtig
auf dem Deck absetzten. Der fahlhäutige Araber wischte sich die Stirn. Er
schaute zu Brugger ebenso herüber, als dieser seine Digitalkamera auslöste.
Sein Gesicht verformte sich zu einem dämonischen Antlitz. Ganz offensichtlich
war der Araber von Bruggers Bilderflut nicht sehr angetan.
Wer
bist du, Araber?! dachte Brugger, doch er konnte sich keinen Reim auf
diese Fratze machen, die ihn so todwünschend anschaute.
Razzin
beobachtete nervös, wie der israelische Eigner des Luxusliners abgeführt wurde.
Er wechselte wieder und wieder sein Körpergewicht von Bein zu Bein, als er
beinahe mitfühlend sagte: „Sie werden den Juden da ebenfalls foltern und
anschließend töten.“. Er nickte seiner selbst hastig zu. „Ja… das werden diese
Leute ganz bestimmt tun…“
Brugger
hatte ihm nicht zugehört. Seine Gedanken verweilten noch immer bei diesem
Araber, dessen Schiff und dem Sarg. Irgendetwas, so hatte er das ungetrübte
Gefühl, irgendetwas stank furchtbar zum Himmel. Doch er wusste einfach nicht,
weshalb seine Nase den Mief roch, ihn sein Gehirn jedoch nicht definieren
konnte. „Was geht da nur vor sich?“, murmelte er leise. „Was geht da nur vor
sich?!“
9
„Sind
wir bald da?“, quengelte Nicole.
„Ja.“,
antwortete Madawi knapp.
„Was
heißt »ja«? Zwei Minuten, zehn Minuten oder eine halbe Stunde?“
Madawi
wisperte mit dem Fahrer des Taxis, dann sagte er: „Wir benötigen noch etwa eine
halbe Stunde, Frau Hauser.“
„Hey,
was ist los?“, fragte Peter. „Alles okay mit dir?“
„Ist
dir schon aufgefallen, dass…“, Nicole beobachtete mit Argusaugen den Verkehr.
Sie runzelte die Stirn, formte mit ihren Lippen einen Spitzmund und sog die
Luft schmatzend in den Mund.
„Was
soll mir aufgefallen sein?“
„Es
sind wenige Leute unterwegs.“
Peter
sah zum Fenster hinaus. „Ja, mag schon sein…“. Er zuckte mit den Schultern.
„Die werden um diese Zeit alle beim Abendessen sitzen.“
„Nein,
da ist was im Busch!“, erwiderte Nicole harsch. „Wir sind hier mitten in
Jerusalem. Wenn da einer glaubt, die Palästinenser nehmen das Massaker von
Ramallah einfach so hin, dann muss derjenige ziemlich bescheuert sein.“
„Danke!“.
Peter nickte gekränkt. „Aber auch ich weiß, dass Jerusalem seit jeher
Brennpunkt zahlreicher Auseinandersetzungen mit unzähligen Toten ist. Und ich
weiß auch, dass Jerusalem übersetzt »Stadt des Friedens« bedeutet. Und zudem
weiß ich, dass auch mein Magen seit geraumer Zeit knurrt.“
„»Stadt
des Friedens« – das ich nicht lache!“, schoss Nicole Peter eine Salve Wahnwitz
entgegen. „Gleich höre ich noch, dass das Heilige Land der Himmel auf Erden
ist. Sag mal…“, Nicole drehte sich Peter zu und schaute ihm verwundert wie
zugleich entsetzt in die Augen. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass du dich auf
unsere Reportagen nicht ausreichend vorbereitest. – Gott, das kann ja wohl
nicht wahr sein, was du hier von dir gibst!“
„Hey,
ich weiß sehr wohl Bescheid!“, verteidigte sich Peter forsch. „Du willst etwas
über die Geschichte Israels wissen? Dann bitte!“
Nicole
schlug die Arme übereinander und verharrte mit gespitzten Ohren. „Bitte!? Was
ist nun?!“
„Das
ist nicht dein Ernst?“
„Okay,
ich hab schon verstanden…“, erwiderte Nicole triezend wie ein kleines Mädchen.
Sie drehte ihren Kopf zur Seite und beobachtete mit gespielter Gleichgültigkeit
den Verkehr. „Ich hab’s ja gleich gewusst…“
„Hey,
hey, hey!“. Peter setzte sich aufrecht hin. In seinen Gedanken suchte er hastig
nach etwas Verwertbarem. Das einzige, was ihm einfallen mochte, war eine
auswendig gelernte Textpassage aus ihrer gemeinsamen Nahost-Schulung. Doch die
wollte er nicht runterplappern. „Ich weiß was ich weiß, aber ich gebe jetzt
ganz gewiss keinen Geschichtsunterricht3.“
„Schon
gut. Auf Geschichte stehe ich jetzt auch nicht.“. Nicole sinnierte: „Jerusalem…
in der »Stadt des Friedens« scheint der Frieden einfach nicht in den Herzen der
Menschen ankommen zu wollen.“
„Tja,
da hast du wohl recht.“, seufzte Peter.
Es
war schon dunkel, als das Taxi vor dem Hotel »American Colony« im Ostteil von
Jerusalem hielt.
„Wir
treffen uns morgenfrüh um zehn hier im Hotel.“, sagte Nicole zu Madawi und
stieg aus. Sie war von oben bis unten mit einer schwarzen Rußschicht bedeckt.
Ihre Haare staubten, als sie sich mit den Fingern frische Luft in ihre Locken
fächerte.
Peter
schnappte sich seine Kamera und folgte dem rußigen Pfad ihrer Fußabdrücke. „Wie
geht es deinem Arm?“, fragte er besorgt.
„Es
geht schon. Wir müssen zu allererst die Aufnahmen überspielen.“
„Das
werde ich auch alleine schaffen.“, entgegnete Peter. „Du wirst dich derweilen
am besten von einem Arzt behandeln lassen.“
„Aber…“
„Glaube
mir, die Aufnahmen kann ich auch ohne deine Hilfe an den Sender überspielen.
Das ist schon okay so.“
Als
die beiden Schornsteinfeger die Treppe zum Hotel hochhasteten, öffnete ihnen der
Portier mit großen Augen die Tür. Doch anstatt ein Mindestmaß an Sauberkeit den
Gästen des Hauses abzuverlangen, verkniff er sich jeglichen Kommentar. Nur
einem Nasenrümpfen hinter dem Rücken der Sauigel konnte er nicht
widerstehen.
Peter
und Nicole wurden bereits erwartet. In der Chill-Out-Ecke saßen zwei Männer in
Anzug und Krawatte und stierten unentwegt auf den Haupteingang, um das
Journalistenduo unter keinen Umständen zu verpassen. Als die beiden dann
schließlich in die Hotellobby traten, kniffen die Männer die Augen beinahe
zeitgleich zu kleinen Schlitzen zusammen. Sie standen blitzschnell auf, zogen
ihre Jacketts zurecht und schnitten Peter mit hastigem Schritt den Weg ab. „Mr.
Morgan?“, fragte der eine, während der andere mit ausgestreckten Armen und
einer leichten Kopfverbeugung Nicole mit aufdringlicher Höflichkeit zu sich her
wünschte. „Und Sie sind Mrs. Hauser?“
„Ja,
zumindest sind wir unter der Rußschicht zu finden.“, antwortete Nicole frech.
„Wer sind Sie?“
„Wir
kommen im Auftrag der israelischen Regierung. Wir sollen Sie in das
Staatsministerium begleiten. Nur für ein paar Fragen; nichts weiter.“,
antwortete einer der Anzugträger höflich, aber bestimmend.
Peters
Kopf lief augenblicklich rot an. „Sie sind vom Mossad!“, stieß er wutentbrannt hervor.
„Es
gibt keinen Grund zur Aufregung. Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen.
Nichts weiter; nur ein paar Fragen.“. Der Agent sah wenig verzückt in die
verwunderten Gesichter der vorübergehenden Hotelgäste und versuchte lässig zu
lächeln, was ihm allerdings äußerst misslang. Vielmehr spiegelte er das steife
Abbild eines ernsten Pierrot-Clowns wider. Mit gedämpfter Stimme fuhr er fort:
„Sie waren doch heute in Ramallah, nicht wahr?“
„Möglich.“,
raspelte Nicoles Zunge forsch.
„Dürften
wir bitte einen Blick auf Ihre Aufnahmen werfen?“
„Nein,
dürfen Sie nicht.“, entgegnete Peter knapp.
Nicole
hatte keine Lust, sich nach diesem beschissenen Tag mit dem Mossad zu
unterhalten und drehte sich den Agenten einfach weg. Sie wollte nur noch auf
ihr Zimmer, sich auf das Bett legen, vom Zimmerservice ein Thunfisch-Sandwich
kommenlassen und nur noch faul die Beine hochlegen. Zumindest hatte sie dies
vor, nachdem sie und Peter die Aufnahmen von Ramallah nach Deutschland
überspielt hatten. Ganz und gar nicht gingen ihre Pläne konform mit dem Wunsch
dieser Mossad-Agenten, die ihnen ganz offensichtlich die wertvolle Tagesarbeit
zensieren wollten und ihnen im schlimmsten Fall das Band ohne Kopie ganz
wegnehmen würden. Und das war am wahrscheinlichsten!
Als
Peter Nicole auf das Zimmer folgen wollte, stellte sich ihm ein Agent in den
Weg, während der andere mit gestreckten Arm und der flachen Hand in Richtung
Hotelausgang zeigte. „Sie müssen verstehen: Unser Chef will Ihre Aufnahmen
sehen und wir sollen sie ihm bringen; mit oder ohne Ihrer Zustimmung, Mr.
Morgan. Sie haben die Wahl.“
„Sehen
Sie nicht wie wir aussehen?!“, raunzte Nicole. „Zwanzig Minuten zum
Frischmachen werden Sie uns schon geben müssen.“
„Gut,
wie Sie wünschen.“
Peter
wollte abermals an den Herren vorbeigehen, als ihn der Agent unwirsch am Arm
festhielt. „Ich werde solange auf Ihre Kamera aufpassen.“, brummte er.
„Das
kommt überhaupt nicht in Frage!“, fauchte Peter brüskiert. „Ich werde Ihnen
meine Kamera auf keinen Fall überlassen!“
„Ihre
Kamera! Bitte!“, blökte der andere Agent dezent und hielt mit der
ausgestreckten Hand Nicole davon ab, Peter zur Hilfe kommen zu können.
„Nehmen
Sie sofort Ihre schmutzigen Hände von mir!“, schrie Nicole lauthals durch die
Lobby, dass sämtliche Augenpaare auf sie starrten.
Der
Agent zog seinen Arm zurück. „Schmutzig…“, er strich sich die Handflächen an
seinem Jackett sauber, „…schmutzig sind eher Sie.“
„Eine
Frechheit! Was bilden Sie sich ein!“
„Genug!“,
stieß der Agent zornig aus seiner Kehle. „Es ist genug! Entweder Sie kommen
sofort ohne weiteres Aufsehen mit uns oder wir verhaften Sie wegen Behinderung
der Staatsgewalt. Wenn Sie Glück haben, dann bekommen Sie so in drei bis vier
Wochen die Möglichkeit, mit einem Anwalt zu telefonieren! – Haben Sie das
kapiert?!“
Es war
für Peter schon schlimm genug, dass er als Journalist zensiert werden sollte,
doch dass sich dieser kleine, schmierige Schnösel ihm nun auch noch in
den Weg stellte, das war für ihn zu viel. Den Knoten im Hals dem Platzen nahe,
formte er seine Hand zur Faust und war gedanklich bereits im Begriff, die
Flugbahn zu berechnen, als er Nicole laut keuchen hörte.
Sie
fasste sich an die Schläfe. Mit einem Mal übermannte sie ein Schwindelgefühl,
das ihre Beine nur mehr wie kraftlose Stelzen umhertaumeln ließ. Nicole verlor
daraufhin das Gleichgewicht, stürzte auf den Boden und schlug sich ihre Wunde
erneut blutig. Ihr Herz pochte so kräftig, dass ihre Halsschlagader wie eine
Raupe zu kriechen begann.
„Einen
Arzt! Schnell! Wir brauchen einen Arzt!“, schrie Peter. „Geben Sie mir ihr
Sakko!“
„Weshalb?“
„Ich
will damit ihren Kopf höher stützen.“. Peter winkte hektisch mit der Hand. „Nun
machen Sie schon oder soll ich es Ihnen ausziehen?“
Widerwillig
folgte der Agent Peters Anweisungen, während er Nicoles Gesicht streng
beobachtete.
Peter knüllte das Sakko zum Verdruss des
Besitzers zu einer Art Kissen zusammen. Zur Stabilisierung des Kreislaufs
erhöhte er Nicoles Beine, indem er ihr seine Kamera unter die Waden legte.
„Wasser.“,
bat Nicole leise. „Bitte… ein Glas Wasser.“
Peter
wollte rasch aufstehen, da griff Nicole nach seinem Arm und hielt ihn zurück.
„Nicht du.“, flüsterte sie und zwinkerte hastig.
„Ah
ja…“, stotterte Peter anfänglich, ehe er begriff. „Holen Sie ihr gefälligst ein
Glas Wasser!“, fauchte er die Agenten forsch an.
Einer
von ihnen schaute sich gemächlich nach einem Kellner um; doch da war keiner.
„Okay, ich hole Ihnen ein Glas Wasser.“, raunzte er schließlich und bequemte
sich widerstrebend um Peters Bestellung.
„In
die Eier.“, flüsterte Nicole.
„Was?“
„Tritt
ihm in die Eier!“
„Ich
kann dich nicht verstehen.“. Peter beugte sich tiefer zu Nicole hinunter.
„Ach
geh weg!“, bellte sie und stieß Peter mit einem Armhieb beiseite. Sie streckte
den Fuß und trat dem verbliebenen Agent mit aller Wucht zwischen die Beine.
Dieser sackte mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Nicole sprang auf, setzte
mit einem weiteren Tritt in die Magengegend nach und lief zum Ausgang. „Komm
schon! Und nimm die Kamera mit!“. Sie rannte Hals über Kopf auf die Straße. Mit
wild fuchtelnden Händen stoppte sie ein Taxi, sprang rein und noch während
Peter die Wagentür schloss, wies sie den Fahrer mit harschen Worten an, endlich
loszufahren.
Die
Mossad-Agenten konnten lediglich noch die Rückleuchten des Taxis erkennen. Sie
telefonierten aufgeregt, rannten eilig quer über die Fahrbahn und versuchten,
dem Taxi den Weg nach einer Kehre abzuschneiden.
Vergebens!
Nicole hatte den Fahrer scharf wenden lassen und die »Men in Black« des Mossad
standen wie betröpfelte Buben im Regen. Doch plötzlich schaltete die Ampel auf
Rot und die Agenten witterten erneut ihre Chance. Blitzschnell rannten sie dem
Taxi hinterher. Es waren nur noch ein paar Meter zwischen ihnen.
„Fahren Sie!“, schrie Nicole.
Der
Taxifahrer zuckte nur hilflos mit den Schultern. „Miss, wir haben rot.“.
„Hundert
Dollar für Sie, wenn Sie auf der Stelle losfahren!“, fauchte Nicole, während
sie hastig einen Hunderter aus ihrer Tasche zog und den Schein dem Fahrer vors
Gesicht hielt. „Wollen Sie sich etwas dazuverdienen oder nicht?!“. Der
Taxifahrer griff nach dem Schein, doch Nicole zog ihn schnell wieder an sich.
„Fahren Sie, dann bekommen Sie die Hundert Dollar! Nun machen Sie schon!“
Der
Taxifahrer krallte seine Hände fest um das Lenkrad, machte seinen Hals ganz
klein und gab Gas. Wie ein irrgewordener Affe preschte er quer über eine
vierspurig befahrene Hauptstraße. Ohne einen Blick nach links oder nach rechts
zu riskieren, fuhr er wagemutig ohne Rücksicht auf Verluste einfach drauf los.
Die Motoren der kreuzenden Autos heulten schrill auf. Rauchwolken quollen aus
den Radkästen, während die Reifengummis dicke, schwarze Spuren auf den Asphalt
zeichneten. Eine Handbreit vor Peters Seitenfenster keilten sich zwei Wagen
frontal ineinander. Keine fünf Meter weiter schleuderte eine ältere
Wagenlenkerin mit ihrem Toyota-Geländewagen quer über die Straße, woraufhin ein
Opel Escort in voller Fahrt in ihren Kofferraum knallte. Ein Mercedeslenker
versuchte, über den Fußgängerweg dem Unfall auszuweichen. Doch mit Ungeschick
lenkte er direkt auf einen Laternenmasten zu und säbelte diesen wie einen
Strohhalm um. Aus dem Kühlergrill zischte eine Dampfwolke und fächerte unter
dem zerbeulten Blech hervor. Unzählige Passanten irrten hysterisch über das
Trümmerfeld, auf der Flucht vor dem heranrasenden Tod. Ein alter Mann schrie
lautstark: „Ein Anschlag! Die Hamas tötet wieder!“, woraufhin sofort eine Welle
der Panik einsetzte und die Menschen mit lautem Gebrüll in alle Richtungen
wegrannten. Es war innerhalb von Sekunden ein Abbild des Schreckens über die
Kreuzung hereingebrochen und niemand vermochte die Banalität zu erahnen, die
der Grund für dieses Chaos gewesen war.
Der
Taxifahrer hingegen hatte die Straße mit dem unvorstellbaren Glück eines Deppen
schadenfrei überquert. Nicole und Peter schauten sich erschrocken wie
erleichtert zugleich um. Sie sahen, wie hinter ihnen Feuerzungen aus den
Autowracks aufstiegen. Sie beobachteten die wild umherirrenden Menschen, hörten
ihre Schreie. Und zu ihrer egoistischen Selbstfreude konnten sie erkennen, dass
die Mossad-Agenten fassungslos der ihnen dargebotenen Szenerie stehen geblieben
waren und die Verfolgung aufgaben.
„Wir
haben sie abgehängt!“, quiekte Nicole freudetrunken, während Peter hektisch mit
dem Kopf nickte: „Ja, ja, ja! Die sind wir los!“
Dann
geschah das Unerwartete. Der Taxifahrer hatte ein Dreiradauto, das ohne Licht
fuhr, nicht rechtzeitig erkennen können
und rammte mit voller Wucht in dessen Seite.
Peter
schlug mit dem Kopf gegen den Vordersitz. Ein fürchterlicher Schmerz bohrte
sich in seine Stirn, woraufhin ihm sein Geist wie in einer Waschmaschine
geschleudert jeglichen weiteren Gedanken verweigerte. Als er sich nach einem
langen Augenblick aus seiner Benommenheit befreien konnte und sich nach Nicole
umsah, war die bereits aus dem Taxi gesprungen.
„Komm
schon!“, schrie sie noch, während sie sich bereits mit rennenden Beinen auf der
Flucht befand. „Die Agenten werden gleich hier sein!“
Peter
riss seine Kamera an sich. Sein Puls schlug rasend in die Höhe. Im Sprint sah
er sich um und konnte sehen, wie die »Men in Black« bereits nur noch wenige
Schritte vom Taxi entfernt waren.
„Hundert
Dollar!“, rief ihnen der Taxifahrer wütend hinterher. „Hey Lady! Was ist mit
meinen Hundert Dollar!“
In
einer dunklen Seitenstraße glaubte Nicole an einen Vorteil. Es gab keine
Laternen, die Licht spendeten. Stattdessen bedeckte die Nacht die
Häuserschlucht unter einem tief schwarzen Mantel. Ihre von Ruß bedeckten Körper
verschmolzen mit der Finsternis. Sie eilten durch eine menschenleere Gasse,
ließen ihre Glieder um die Häuserecken fliegen und forderten ihre Beinmuskeln
unbarmherzig dazu auf, auch noch die letzten Kraftreserven zu mobilisieren.
Wären ihre klackenden Absätze nicht über die nunmehr mit Steinplatten bedeckte
Erde getönt, so wären sie lautlos immer tiefer und tiefer in die Labyrinth
ähnliche Altstadt von Jerusalem hineingeschwebt. Nach schier endloser Zeit
hielten sie keuchend inne und verkrochen sich wie Igel in der hintersten Ecke
eines Hinterhofes. Sie waren sich so nah, dass Nicoles warmer Atem Peters Ohren
erhitzte. Und im Schweiße ihrer Angst belauschten sie die Nacht.
„Ich
glaube wir haben sie abgehängt.“, flüsterte Nicole nach einer Weile.
„Pssst!“.
Peter hatte vage in der Ferne ein Geräusch vernommen. Es klang wie ein
metallisches Staksen. Es polterte; dann folgte ein leises Knurren.
Nicole
suchte hinter Peters Rücken Schutz. Mit hastig kreisenden Blicken versuchte sie
etwas in der Dunkelheit zu erkennen, doch es bewegte sich… nichts.
Stille.
Plötzlich
huschte ein Schatten über die Gasse. Er kam direkt auf sie zu.
„Was
ist das?“, fragte Nicole leise. „Etwa eine…“
„…Ratte.“,
ergänzte Peter, während er erleichtert tief Luft holte. „Nichts weiter, nur eine
Ratte.“. Er knurrte wie ein Hund, woraufhin das Fellbündel abkehrte und in
einer Häusernische verschwand. „Ich glaube die »Men in Black« sind wir los.“
„Was
machen wir jetzt?“, flüsterte Nicole. Sie stützte ihren Oberkörper mit
gestreckten Armen auf der Straße auf, schüttelte mit dem Kopf, ehe sie sich
schließlich total erschöpft auf die Steinplatten niederließ.
„Ist
mit dir alles okay?“
„Die
Wunde pocht.“, antwortete sie knapp. Sie inhalierte den nächtlich reinen
Sauerstoff in ihre Lunge. „Mir ist ein wenig schwindelig, aber es geht schon.“
„Eine
Ohnmacht wäre jetzt auch echt schlecht.“
„Danke
für dein Mitgefühl. – Männer!“, stöhnte Nicole leise. „Ich ruf Madawi an.
Vielleicht hat der eine Idee, wo wir jetzt noch die Aufnahmen nach Deutschland
überspielen können. Ins Hotel können wir jedenfalls nicht mehr zurück.“
Die
Nacht war klar und rein. Bei stolzen 28°C kurz vor 23 Uhr hauchte ein lauer
Wüstenwind durch die Gassen und föhnte dabei die frisch gewaschenen Kleider der
Menschen, die an zwischen den Häusern gespannten Seilen hin und her wippten. Es
roch nach Seife. Ein Frühlingsduft wie eine blühende Wiese lag wie ein
unsichtbarer Nebel in der Luft.
„Wir
sollen zum Fernsehsender Al-Jaz gehen.“. Nicole schüttelte ihre Gliedmaßen aus
und befreite sich so von ihrer Schlaffheit. Sie fühlte, wie die Kraft in ihren
Körper langsam zurückkehrte und sich ihr Kreislauf wieder stabilisierte. „Das
Büro befindet sich im Muslimischen Viertel im Nordosten der Altstadt. Er wird
auch hinkommen.“
„Okay,
gehen wir.“, krächzte Peters Stimme rau. Er räusperte sich und schaute sich
verstohlen um. „Wo geht’s lang?“
„Scheiße;
was weiß ich?!“
„Alles
gut.“. Er hob sanft die flachen Hände und ließ sie beruhigend in Richtung Boden
sinken. „Lass mich mal sehen…“. Peter versuchte mit Logik ihren Aufenthaltsort
auf der wagen Straßenkarte vor seinem inneren Auge zu finden. Er sah sich um
und erkundete aufmerksam die unmittelbare Umgebung nach Denkmälern, heiligen
Gebäuden und nach öffentlichen Plätzen. „Da lang.“. Die unzähligen Lichter, die
an den Berghügeln wie funkelnde Stecknadelköpfe hell über die Nacht
erstrahlten, versuchte er ebenfalls einem Stadtteil zuzuordnen.
Doch
seine Müh trug für Nicoles Begriffe keine Früchte. Frustriert fragte sie nach
einer Weile: „Hast du eigentlich einen Plan wohin wir gehen? Ich habe so das
Gefühl, dass du eigentlich keinen Plan hast, wo wir hier sind.“
„Sorry,
aber die Menschen in den Häusern hier schlafen schon, da können wir niemanden
fragen. Wir gehen einfach weiter in diese Richtung und nehmen uns an der
nächsten Hauptverkehrsstraße ein Taxi.“, bläffte Peter. „Das ist doch ein guter
Plan, oder etwa nicht?“
„Wahllos
in eine Richtung gehen… das ist also dein ganzer Plan.“, wiederholte Nicole
Peters Worte mit weitaus weniger Begeisterung als ihr Kollege seine Idee
präsentiert hatte. „Und für so einen Schwachsinnsplan irre ich dir jetzt schon
eine halbe Stunde hinterher! Was glaubst du eigentlich, wie viel Einwohner hat
die Stadt?“
„So
etwa eine dreiviertel Million.“
„Ja,
genau!“, fauchte Nicole angesäuert. „Wenn wir Pech haben, dann haben wir in
diesem Labyrinth bis übermorgen noch kein Taxi gefunden.“
„Da
kannst du schon recht haben.“, stimmte Peter ihr zu. „Aber vielleicht hilft uns
ja ein wenig Geschichtskenntnis weiter.“
„Wie
das?“
„Die
Altstadt Jerusalems liegt im Nordosten der Stadt. Sie ist von einem 4.325 Meter
langen Mauergürtel umgeben, den der Sultan »Suleiman der Prächtige« Anfang des
16. Jahrhunderts zum Schutz vor einem drohenden Kreuzzug von Kaiser Karl V.
erbauen ließ. Es existiert voneinander abgegrenzt ein Jüdisches Viertel, ein
Muslimisches Viertel, ein Armenisches und ein Christliches Viertel.“, erklärte
Peter. „Wie du richtig erkannt hast, ist
die alte Downtown ein Labyrinth aus engen Gässchen, bespickt mit kleineren,
freien Plätzen. Bei Tageslicht verzaubert ein Schattenspiel über ein
faszinierendes Konglomerat bestehend aus unzähligen Kirchen mit ihren hohen
Türmen, Moscheekuppeln mit ihren schlanken Minaretten, zerklüftete
Dachterrassen, Fetzen von Gartenparzellen und dem Wirrwarr orientalischer
Geschäftsschluchten…“
„Das
heißt dann wohl, wir befinden uns hier in Downtown?“, fragte Nicole
erwartungsvoll dazwischen.
„Ich
denke ja.“, erwiderte Peter, seine eigene Aussage gleich wieder einschränkend.
Nicole
klatschte sich die flache Hand auf ihre Stirn. „Du denkst. Na bravo! Hast du
sonst noch etwas Geschichte auf Lager?“
„Nirgendwo
auf der Welt4…“
„Hey!
Hallo!“, unterbrach Nicole Peter und schüttelte ihn sanft an der Schulter.
„Schön, dass du so viel weißt, doch ich will hier weg. Schon vergessen: Wir
müssen zu dem Fernsehsender! Kapiert?!“
Peter
hielt kurz inne, dann räusperte er sich und malte mit der Hand eine eher
spärliche Wegbeschreibung in die Luft. „Also gut… da lang!“
„Wieso
jetzt da lang und nicht … da lang?“, fragte Nicole mit zuckenden Schultern.
„Eben
deshalb.“
„Was
soll das jetzt schon wieder heißen: eben deshalb?“
„So
halt.“, brummte Peter und ging mit schnellen Schritten voran.
Lichtfetzen
spärlich verteilter Straßenlaternen erleuchteten nur minder wenige der unzähligen
Gassen. Eine rastlose Stille umwob die Häuser, wobei lediglich in weiter
Entfernung ein kaum wahrnehmbares, monotones Brummen einen Hintergrund
inszenierte.
Nach
langen Minuten kommunikativer Ruhephase durchschnitt Nicole das Band der
Stille. „Die Menschen schlafen. Es scheint hier alles so friedlich zu sein. Was
glaubst du, Peter: Ist Jerusalem bei Nacht wirklich friedlicher als am Tag?“,
sinnierte sie in melancholischer Trance. „Ich meine, jede Stadt ist doch
normalerweise am Tag friedlicher als bei Nacht. Doch wenn ich sehe, wie oft wir
heute um unser Leben bangen mussten, dann Gnade uns Gott, wenn die Nacht noch
schlimmer werden sollte als der Tag.“
„Und
wir sind nur zu Besuch hier. Wie muss das für die Menschen sein, die hier leben
müssen.“, antwortete ihr Peter von tiefer, innerer Bedrücktheit geleitet. „Die
Kinder hier wachsen in einer Welt auf, die von Hass und Gewalt geprägt ist. Der
Tod ist der Menschen ständiger Begleiter: Sei es, dass die Mütter ihre Kinder
morgens zur Schule bringen, Väter zur Arbeit fahren, Teenager am Nachmittag
bummeln gehen oder nur mal ebenso in einem Café sitzen und mit ihren Freunden
plaudern – ständig lauert auf sie die Gefahr, von einem Selbstmordattentäter in
die Luft gesprengt zu werden. Für uns als Europäer ist so ein Leben
unvorstellbar. Überleg mal was für ein Gefühl es wäre, wenn wir mit jedem
Schritt, den wir zu Hause in Köln, Stuttgart oder in Berlin tun würden, mit der
Angst leben müssten, jederzeit bei einem Selbstmordanschlag getötet zu werden.“
„Oder
es kann jeden Moment an der Tür klingeln, zwei Polizisten warten bis du öffnest
um dir mitzuteilen, dass dein Mann soeben vor dem Kaufhaus in Fetzen gebombt
wurde, als er dir zum Hochzeitstag einen Ring kaufen wollte.“, seufzte Nicole.
„Wo kommt nur dieser unmenschliche Hass her, den die Menschen hier weit ab von
Europa aufeinander haben5?“. Sie wandte ihren Blick in Stille zu
Gott und mochte ihn am liebsten fragen: Gefällt es dir zuzusehen, wie deine
Kinder sich auf der Erde gegenseitig umbringen oder wieso schaust du nur
tatenlos diesem grausamen Morden zu?
Nicole
ging einige Minuten wortlos neben Peter her. Ihre Gedanken versteiften sich an
den Schicksalen der Opfer der unzähligen Selbstmordanschläge. Es ist
unmöglich sich seiner Tränen zu schämen, wenn man bedenkt, wie viel Leid
Jerusalem in den Tausenden von Jahren seit seiner Gründung schon hat ertragen
müssen. Es ist nicht zu verstehen, dass es Menschen gibt, die ihre Kinder für
den Märtyrertod heranziehen und ihnen in ihre unschuldigen, kleine Köpfe
einimpfen, dass sie sterben müssen, nur weil die Eltern nicht dazu bereit sind,
ihnen eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Wie lange wird die Heilige Stadt
des Friedens den Tod als seinen ständigen Begleiter denn noch ertragen müssen?
Wie lange noch wird die Liebe durch den Hass unterdrückt, werden die Menschen
auf dem Weg in das Paradies den Weg durch die Hölle gehen müssen? Wie lange
noch? Nicole fuhr sich durch die Haare. Sie schaute von einer inneren
Besinnlichkeit übermannt in den Himmel empor und konnte fühlen, wie ihr
Mitgefühl für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde, der das Unglück in
seinem Leben erfahren musste, einen Feind zu haben, in ihrem Herzen schmerzte,
wie ihre Seele leise weinte.
Plötzlich
wurde sie jäh aus ihren Gedanken gerissen. Ein Mann kam aus einem Hinterhof
gerannt. Er strich so knapp an ihrer Seite vorbei, dass sie seinen rauchigen
Atem riechen konnte. Er packte Nicole mit festem Griff von hinten am Arm und
drückte ihr ein Messer in die Nieren. Mit weit aufgerissenen Augen fauchte er
ihr ganz dicht in ihr Ohr: „Your money, please!“, und erschnüffelte wie ein
Hund den Geruch ihrer Haare.
„Nix
money!“, schrie Nicole. Und noch ehe Peter reagieren konnte, löste sie sich mit
einer geschickten Drehung aus dem Griff des Mannes, schnellte mit dem Knie hoch
und traf ihn haargenau zwischen den Beinen.
Der
Mann krümmte sich augenblicklich vor Schmerzen. Er verdrehte wie eine Eule die
Augen und jaulte wie ein Werwolf den Mond an. Mit hüpfenden Beinen wich er
einem weiteren Tritt von Nicole aus und verschwand wieder so rasch in der
Dunkelheit wie er gekommen war.
„Alles
okay?“
„Ja.“.
Nicole fasste sich an ihren verletzten Arm. Er schmerzte sie wieder. „So ein
verdammtes Arschloch!“
„Wir
sollten so schnell wie möglich zu dem Sender Al-Jaz. Wer weiß, was uns heute
noch alles passiert!“, sagte Peter mit missmutiger Miene.
Als
sie eine Anhöhe hinaufgingen und auf der anderen Seite des Hügels ein Tal von
Gassen einsahen, ergriff sie eine unheilvolle Vorahnung. Sie blickten auf eine
Unzahl von Männern, die fieberhaft umherrannten. Einige sammelten sich über die
Via Dolorosa6. Weitere Männer formierten sich in Hinterhöfen zu
kleinen Gruppen und zogen gemeinsam Richtung Norden. Aus der Ferne dröhnte ein
Stimmenwirrwarr durch die Altstadt von Jerusalem. Immer noch mehr und noch mehr
Männer drängten auf die Straße. Manche von ihnen hielten Fackeln in der Hand.
Und aus ihren Kehlen dröhnte es wie aus einem Mund: »Allâhu Akbar! Allâhu
Akbar! Tod den Juden!«
„Was
geht hier vor?!“, fragte Nicole mit zitternder Stimme. „Wo wollen die alle
hin?“
„Das
sieht nicht gut aus.“. Peter schulterte seine Kamera und begann zu filmen. „Ich
habe das Gefühl, dass das heute noch eine heiße Nacht werden wird!“
Hunderte
von muslimischen Männern hatten sich am Fuße des Tempelbergs versammelt. Sie
reckten die Fäuste in die Luft und brüllten lautstark immer und immer wieder im
Chor: »Allâhu Akbar! Allâhu Akbar! Tod den Juden!« Eine Gruppe Jugendlicher
verbrannte in Mitten der Menschenmenge eine israelische Flagge. Weiter hinten
im Gewühl fraßen Flammen eine amerikanische Flagge auf. »Allâhu Akbar! Allâhu
Akbar! Tod den Juden!«.
„Verdammt
nochmal, das sieht wirklich nicht gut aus!“, brummte Peter, während er
versuchte, möglichst viele spektakuläre Bilder auf einmal einzufangen.
„Dann
sind wir hier wohl im Arabischen Viertel.“, stellte Nicole nüchtern fest.
„Denkst du, der Aufmarsch hat etwas mit dem Massaker von heute Mittag in
Ramallah zu tun?“
„Ganz
sicher! Da würde ich meinen Kopf drauf wetten!“
Plötzlich…
in Mitten der Krawalle, formten sich Nicoles Gesichtszüge zu einem kindlichen
Strahlen. „Da…!“, stotterte sie anfänglich. „Da ist der Sender Al-Jaz!“, und
mit Zuversicht im Herzen zeigte sie mit dem Finger auf das Gebäude. „Wir haben
es geschafft!“
„Schau
dort!“. Peter verstand es, ihr die Freude von einer auf die andere Sekunde
wieder zu nehmen. „Da sind die beiden Typen vom Hotel!“, erwiderte er weniger
verzückt.
„Welche
beiden Typen?“
„Die
»Men in Black« des Mossad!“, seufzte er und deutete mit seinem Kinn auf zwei
finster dreinblickende Gestalten nicht mehr als Hundert Meter von ihnen
entfernt. „Da hast du die CD. Du gehst jetzt da rein und regelst die
Überspielung, während ich die beiden ablenke.“
Peter
schulterte die Kamera, ging direkt auf die Agenten zu und filmte sie in
Großaufnahme. Seine Aktion missbilligten sie mit wütenden Gesichtsfratzen. Ein
Agent packte Peter mit festem Griff im Nacken, während der andere seine Hand
über die Linse hielt und die Kamera mit Gewalt an sich riss. Da spürte Peter
einen eisigen Schmerz ausgehend von einem Elektroschocker in seine Lenden
einschießen, der sich im Bruchteil einer Sekunde in seinem Körper ausbreitete
und ihn lähmte. Er biss die Zähne zusammen, während sein Kopf nur noch schreien
wollte.
Ein
dritter Agent musterte unterdessen den tobenden Mob. Er ließ seinen Blick
hastig über die Gesichter der Menschen eilen, als er Nicole kurz vor der Tür zu
Al-Jaz entdeckte.
„Da
ist sie!“, schrie er lauthals. Daraufhin ließen seine Kollegen Peter wie einen
Kartoffelsack fallen. Wie Bulldozer bahnten sie sich gemeinsam durch die Menge.
Nicole
hatte die Türklinke bereits in der Hand, als sie abrupt stehen blieb. Sie
fasste sich an die Stirn, verdrehte die Augen und sackte ohnmächtig zu Boden.
Ein Mann
trennte sich blitzschnell aus der Menschenmenge. Er beugte sich über Nicoles
reglosen Körper, packte sie ohne Zögern und stemmte sie über seine Schultern.
Sie haben Lust auf mehr?